Montag, 2. Februar 2015
Unfreiwilliger Epilog: Kafka war ein Realist
wernerbaumann, 11:27h
„Haben Sie beachtet, wie freundlich der Offizier zu uns war?“, sagte Ma Jiao, die Mitarbeiterin der Schule zu mir, als wir nach zwei Stunden das Büro verliessen. „Das ist ein gutes Zeichen.“ Dass Zeichen das einzige waren, was mir zur Beurteilung der Situation übrigblieb, musste ich bald begreifen.
Mein Flug von Xian nach Paris war auf nachts 1 Uhr terminiert. Alles war reibungslos gelaufen – der Transport zum Flughafen, das Einchecken (die nette Mitarbeiterin der chinesischen Airline hatte sogar den zu schweren Koffer durchgewinkt mit der Bemerkung, ich solle das nächste Mal besser schauen). Bei der Passkontrolle wurde mir bedeutet, mit dem Visum stimme etwas nicht. Ich holte meine Arbeitsbewilligung und die Kopie meiner temporären Niederlassungs- bewilligung aus dem Koffer und legte sie dem säuerlichen Beamten triumphierend hin. Der aber liess sich nicht beirren und rief einen Kollegen hinzu; dieser verschwand mit den Dokumenten und kam mit einem weiteren, offenbar höhergestellten, zurück, der schliesslich nach langem Hin und Her erklärte, ich könne nicht ausreisen. Weder mein Hinweis, dass ich ja gehen und nicht kommen wolle, noch meine Flüche auf Englisch und Schweizerdeutsch lösten die geringste Reaktion aus. Ein Anruf bei Ma Jiao und deren Gespräch mit den Beamten bewirkte ebenso wenig.
So stand ich um Mitternacht in der Halle des Flughafens, der eine Stunde weit weg von Xian liegt. Eine nette junge Dame der Airline, die für mich übersetzt hatte und der die ganze Geschichte furchtbar peinlich war, kümmerte sich anschliessend darum, dass mein Koffer zurückgeholt wurde und dass ich im Hotel am Flughafen ein vergünstigtes Zimmer erhielt. Ich schlief wenig und schlecht.
Am nächsten Morgen rief mich Ma Jiao an, sie komme zum Flughafen, wolle sich dort erkundigen, was das Problem sei, und hole mich dann ab. Um halb zehn teilte sie mir mit, sie warte immer noch, bis jemand erscheine; die Passkontrolle sei nicht besetzt, weil es zwischen acht Uhr und Mittag keine Auslandflüge gebe. Erst gegen Mittag kam sie, erklärte, es fehle mir offenbar ein Dokument; genau jenes,das sie im September mit mir hatte machen wollen (ich hatte dafür extra eine aktuelle elektronische Foto von mir machen lassen), das aber noch vor dem angesetzten Termin vom Amt für überflüssig erklärt worden war, da ich nur ein halbes Jahr in China bleibe. Nun musste das Ganze rekonstruiert werden, dafür musste ich mit ihr am Nachmittag auf das Ein- und Auswanderungsamt.
Dieses liegt etwa Dreiviertel Taxistunden von der Schule entfernt. In der Eingangshalle sassen und standen zahlreiche Wartende. Wir jedoch gingen an allen vorbei zum Lift und direkt in den 18. Stock, denn Ma Jiao hatte bereits am Vormittag alle ihre Beziehungen spielen lassen, insbesondere wertvoll sei ihre Tante, die irgendwo bei einem Amt arbeite und den hier zuständigen Abteilungsleiter kenne, so dass wir bevorzugt schnell behandelt würden. Ich hoffte am Abend via Peking fliegen zu können, so dass ich am nächsten Tag zu Hause wäre.
Im 18. Stock reihte sich Büro an Büro, jeweils von drei bis sechs Leuten an ihren Pulten besetzt, teils uniformiert, teils locker gekleidet. Die einen arbeiteten, die andern spielten mit ihren Handys. Wir setzten uns in ein Büro, in welchem verschiedene Menschen einen grossgewachsenen Mann an einem Pult bedrängten. Er hörte sich einen um den andern an, kopierte Ausweise und leitete sie in andere Büros weiter. Auch wir wurden in eines geschickt, wo ein Beamter sich zuerst lange mit Ma Jiao besprach, bevor der junge Offizier ins Spiel kam und uns übernahm. Dieser erstellte schliesslich ein Protokoll, das Ma Jiao mir übersetzte; ich musste unterschreiben und alle Zahlen und Namen mit einem roten Fingerabdruck beglaubigen. Im Büro mit vier Pulten - drei Männer, eine Frau -, das wie viele Räume hier ein wenig schmuddlig war, herrschte eine ruhige Stimmung, auch hier eine Mischung von Handy und Arbeit, ab und zu klingelte das Telefon. Da nun ein anderer Beamter mit Ma Jiao ein Protokoll erstellte,hatte der freundliche junge Offizier Zeit, mir nach rund 17 Stunden Verwirrung ansatzweise das Problem zu erklären: aufgrund eines Fehlers hätte ich seit Monaten quasi illegal in China gelebt, denn die Zahl 000 auf meinem Visum bedeute eigentlich 30, die Gültigkeit sei also nur 30 Tage. Das musste jetzt ausgebügelt werden (dazu gehört auch eine Busse für die Schule). Anschliessend wollte er – er konnte leidlich Englisch - mit mir über die Schweiz plaudern und dies und das wissen.Am Ende des Nachmittags war klar, das würde heute nicht fertig.
Ma Jiao hatte den Auftrag, eine ausführliche Darstellung der Schule einzureichen. Die würde sie in der Nacht machen und am nächsten Morgen sofort bringen. Die Schwierigkeit bestehe darin, erklärte sie mir, dass wir drei Unterschriften von drei Ebenen bräuchten. Das könne, wenn die Herren gerade im Büro seien, sehr schnell gehen, oder eben auch nicht. Normalerweise würden solche Fälle ein bis zwei Wochen dauern – ich erstarrte; aber dank der verschiedenen Beziehungen hätten sie zugesagt, es schnell und reibungslos zu erledigen – ich hoffte also auf den nächsten Tag: das war Freitag, dann kam das Wochenende ... Zwanzig Stunden, nachdem ich sie verlassen hatte, sass ich nun wieder in meiner geputzten leeren Wohnung mit zwei offenen Koffern und versuchte mich vom Schock zu erholen.
Den Freitag Morgen verbrachte Ma Jiao auf dem Amt. Es habe leider nichts genützt, berichtete sie am Nachmittag, sie sei den Beamten auf die Nerven gegangen, das sei eher kontraproduktiv, deshalb sei sie zurückgekommen. Es bleibe nichts, als über das Wochenende zu warten. Wir reservierten einen Flug für Montag abend. Die Schweizer Botschaft in Peking, die ich unterdessen angerufen hatte, erklärte mir freundlich, dass sie nichts für mich tun könne, denn in Visa-Angelegenheiten seien die Chinesen strikt. Der noch freundlichere Herr auf der chinesischen Botschaft in Bern fand die Angelegenheit auch komisch; nachdem er sich bei Ma Jiao kundig gemacht hatte, glaubte auch er, dass eine Intervention der Botschaft via das Aussenministerium in Peking die Behörden hier eher bockig machen könnte und wohl nichts zur Beschleunigung beitragen würde.
Also Wochenende. Bei der Verkürzung halfen am Samstag ein amüsantes Konzert der Pekinger Philharmonie und am Sonntag ein Nachtessen bei einer jungen Kollegin zu Hause, deren Vater sich und mir ausdauernd Schnaps nachschenkte.
Heute Montag Mittag berichtete Ma Jiao, dass die Unterschriften von zwei Ebenen erreicht seien, bevor die dritte gegeben werde, müsse aber noch der Direktor der Schule zum Amt und seine Einvernahme protokolliert werden. Es reiche also auch heute leider nicht. Übermorgen ist der wichtigste Anlass des Jahres für meine Frau, auf den hin meine Rückreise terminiert war: Sie wird als Grossratspräsidentin ihre Antrittsrede halten und am Abend gefeiert. Den Vormittag hab ich mal schon verpasst. Ich hoffe also unruhig auf morgen – mit 80-90% Sicherheit sei die Sache morgen erledigt, sagt Ma Jiao. Ein anderes Zeichen habe ich nicht.
P. S. Typisch China? Ich weiss es nicht. Vermutlich könnte man in vielen Ländern, auch in Europa, ähnliches erleben. Immerhin: Im Gegensatz zu Russland, wo ich vor ein paar Jahren auf der Polizei nur angebrüllt wurde, weil ich bestohlen worden war, waren alle involvierten Personen korrekt oder sogar freundlich (bis jetzt ...).
Mein Flug von Xian nach Paris war auf nachts 1 Uhr terminiert. Alles war reibungslos gelaufen – der Transport zum Flughafen, das Einchecken (die nette Mitarbeiterin der chinesischen Airline hatte sogar den zu schweren Koffer durchgewinkt mit der Bemerkung, ich solle das nächste Mal besser schauen). Bei der Passkontrolle wurde mir bedeutet, mit dem Visum stimme etwas nicht. Ich holte meine Arbeitsbewilligung und die Kopie meiner temporären Niederlassungs- bewilligung aus dem Koffer und legte sie dem säuerlichen Beamten triumphierend hin. Der aber liess sich nicht beirren und rief einen Kollegen hinzu; dieser verschwand mit den Dokumenten und kam mit einem weiteren, offenbar höhergestellten, zurück, der schliesslich nach langem Hin und Her erklärte, ich könne nicht ausreisen. Weder mein Hinweis, dass ich ja gehen und nicht kommen wolle, noch meine Flüche auf Englisch und Schweizerdeutsch lösten die geringste Reaktion aus. Ein Anruf bei Ma Jiao und deren Gespräch mit den Beamten bewirkte ebenso wenig.
So stand ich um Mitternacht in der Halle des Flughafens, der eine Stunde weit weg von Xian liegt. Eine nette junge Dame der Airline, die für mich übersetzt hatte und der die ganze Geschichte furchtbar peinlich war, kümmerte sich anschliessend darum, dass mein Koffer zurückgeholt wurde und dass ich im Hotel am Flughafen ein vergünstigtes Zimmer erhielt. Ich schlief wenig und schlecht.
Am nächsten Morgen rief mich Ma Jiao an, sie komme zum Flughafen, wolle sich dort erkundigen, was das Problem sei, und hole mich dann ab. Um halb zehn teilte sie mir mit, sie warte immer noch, bis jemand erscheine; die Passkontrolle sei nicht besetzt, weil es zwischen acht Uhr und Mittag keine Auslandflüge gebe. Erst gegen Mittag kam sie, erklärte, es fehle mir offenbar ein Dokument; genau jenes,das sie im September mit mir hatte machen wollen (ich hatte dafür extra eine aktuelle elektronische Foto von mir machen lassen), das aber noch vor dem angesetzten Termin vom Amt für überflüssig erklärt worden war, da ich nur ein halbes Jahr in China bleibe. Nun musste das Ganze rekonstruiert werden, dafür musste ich mit ihr am Nachmittag auf das Ein- und Auswanderungsamt.
Dieses liegt etwa Dreiviertel Taxistunden von der Schule entfernt. In der Eingangshalle sassen und standen zahlreiche Wartende. Wir jedoch gingen an allen vorbei zum Lift und direkt in den 18. Stock, denn Ma Jiao hatte bereits am Vormittag alle ihre Beziehungen spielen lassen, insbesondere wertvoll sei ihre Tante, die irgendwo bei einem Amt arbeite und den hier zuständigen Abteilungsleiter kenne, so dass wir bevorzugt schnell behandelt würden. Ich hoffte am Abend via Peking fliegen zu können, so dass ich am nächsten Tag zu Hause wäre.
Im 18. Stock reihte sich Büro an Büro, jeweils von drei bis sechs Leuten an ihren Pulten besetzt, teils uniformiert, teils locker gekleidet. Die einen arbeiteten, die andern spielten mit ihren Handys. Wir setzten uns in ein Büro, in welchem verschiedene Menschen einen grossgewachsenen Mann an einem Pult bedrängten. Er hörte sich einen um den andern an, kopierte Ausweise und leitete sie in andere Büros weiter. Auch wir wurden in eines geschickt, wo ein Beamter sich zuerst lange mit Ma Jiao besprach, bevor der junge Offizier ins Spiel kam und uns übernahm. Dieser erstellte schliesslich ein Protokoll, das Ma Jiao mir übersetzte; ich musste unterschreiben und alle Zahlen und Namen mit einem roten Fingerabdruck beglaubigen. Im Büro mit vier Pulten - drei Männer, eine Frau -, das wie viele Räume hier ein wenig schmuddlig war, herrschte eine ruhige Stimmung, auch hier eine Mischung von Handy und Arbeit, ab und zu klingelte das Telefon. Da nun ein anderer Beamter mit Ma Jiao ein Protokoll erstellte,hatte der freundliche junge Offizier Zeit, mir nach rund 17 Stunden Verwirrung ansatzweise das Problem zu erklären: aufgrund eines Fehlers hätte ich seit Monaten quasi illegal in China gelebt, denn die Zahl 000 auf meinem Visum bedeute eigentlich 30, die Gültigkeit sei also nur 30 Tage. Das musste jetzt ausgebügelt werden (dazu gehört auch eine Busse für die Schule). Anschliessend wollte er – er konnte leidlich Englisch - mit mir über die Schweiz plaudern und dies und das wissen.Am Ende des Nachmittags war klar, das würde heute nicht fertig.
Ma Jiao hatte den Auftrag, eine ausführliche Darstellung der Schule einzureichen. Die würde sie in der Nacht machen und am nächsten Morgen sofort bringen. Die Schwierigkeit bestehe darin, erklärte sie mir, dass wir drei Unterschriften von drei Ebenen bräuchten. Das könne, wenn die Herren gerade im Büro seien, sehr schnell gehen, oder eben auch nicht. Normalerweise würden solche Fälle ein bis zwei Wochen dauern – ich erstarrte; aber dank der verschiedenen Beziehungen hätten sie zugesagt, es schnell und reibungslos zu erledigen – ich hoffte also auf den nächsten Tag: das war Freitag, dann kam das Wochenende ... Zwanzig Stunden, nachdem ich sie verlassen hatte, sass ich nun wieder in meiner geputzten leeren Wohnung mit zwei offenen Koffern und versuchte mich vom Schock zu erholen.
Den Freitag Morgen verbrachte Ma Jiao auf dem Amt. Es habe leider nichts genützt, berichtete sie am Nachmittag, sie sei den Beamten auf die Nerven gegangen, das sei eher kontraproduktiv, deshalb sei sie zurückgekommen. Es bleibe nichts, als über das Wochenende zu warten. Wir reservierten einen Flug für Montag abend. Die Schweizer Botschaft in Peking, die ich unterdessen angerufen hatte, erklärte mir freundlich, dass sie nichts für mich tun könne, denn in Visa-Angelegenheiten seien die Chinesen strikt. Der noch freundlichere Herr auf der chinesischen Botschaft in Bern fand die Angelegenheit auch komisch; nachdem er sich bei Ma Jiao kundig gemacht hatte, glaubte auch er, dass eine Intervention der Botschaft via das Aussenministerium in Peking die Behörden hier eher bockig machen könnte und wohl nichts zur Beschleunigung beitragen würde.
Also Wochenende. Bei der Verkürzung halfen am Samstag ein amüsantes Konzert der Pekinger Philharmonie und am Sonntag ein Nachtessen bei einer jungen Kollegin zu Hause, deren Vater sich und mir ausdauernd Schnaps nachschenkte.
Heute Montag Mittag berichtete Ma Jiao, dass die Unterschriften von zwei Ebenen erreicht seien, bevor die dritte gegeben werde, müsse aber noch der Direktor der Schule zum Amt und seine Einvernahme protokolliert werden. Es reiche also auch heute leider nicht. Übermorgen ist der wichtigste Anlass des Jahres für meine Frau, auf den hin meine Rückreise terminiert war: Sie wird als Grossratspräsidentin ihre Antrittsrede halten und am Abend gefeiert. Den Vormittag hab ich mal schon verpasst. Ich hoffe also unruhig auf morgen – mit 80-90% Sicherheit sei die Sache morgen erledigt, sagt Ma Jiao. Ein anderes Zeichen habe ich nicht.
P. S. Typisch China? Ich weiss es nicht. Vermutlich könnte man in vielen Ländern, auch in Europa, ähnliches erleben. Immerhin: Im Gegensatz zu Russland, wo ich vor ein paar Jahren auf der Polizei nur angebrüllt wurde, weil ich bestohlen worden war, waren alle involvierten Personen korrekt oder sogar freundlich (bis jetzt ...).
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 24. Januar 2015
Entspannt unter rigider Diktatur?
wernerbaumann, 10:43h
Ich habe hier in Xian – wie im letzten Beitrag beschrieben - eine recht entspannte Gesellschaft kennengelernt. Wie geht das zusammen mit der Tatsache, dass China eine Einparteiendiktatur ist, welche nach der Meinung fast aller westlichen Medien die Schraube in Sachen Zensur und Unterdrückung von Kritikern in den letzten Jahren eher angezogen hat?

Ich versuche im folgenden nicht eine politische Einschätzung der jetzigen Situation zu geben. Ich möchte hier auch nicht zu einer Kritik der westlichen Berichterstattung über China ausholen – obwohl ich mich manchmal schon gewundert habe: Am Tag, nachdem ich die grosse Freiluft-Weihnachtsfeier der Katholiken besucht habe und die ganze Innenstadt von feiernden Chinesen überfüllt war, las ich im SPIEGEL, die chinesische Führung wolle Weihnachten unterdrücken. Und jetzt Ende Januar berichten die meisten deutschsprachigen Zeitungen, dass der Smog in Chinas Städten unerträglich sei - hier in Xian ist aber gerade dieses Jahr das Gegenteil der Fall: seit drei Monaten fast immer schönes Wetter, an drei Vierteln der Tage scheint die Sonne; dass es viel schöner als üblich sei, sagen hier alle – ob wegen des milden Winters oder wegen der Massnahmen gegen die Luftverschmutzung, weiss niemand. Einmal mehr gilt es die Grösse des Landes zu bedenken. Wenn in irgendeiner ostchinesischen Stadt die Weihnachtsfeierlichkeiten behindert werden, so ist das nicht China, und wenn es in Peking Smog hat, so heisst das noch nicht, dass es überall so ist.
Keine politische Einschätzung also, nur ein paar Beobachtungen aus der Froschperspektive in einem der eher ärmeren Stadtteile einer chinesischen Grossstadt.
Beobachtung 1: Das chinesische Regime mischt sich wenig ins Alltagsleben der Bevölkerung ein. Alle Chinesinnen und Chinesen, die ich danach gefragt habe, sagten, sie fühlten sich frei in ihrer Lebensgestaltung; und das ist den meisten jüngeren Menschen wichtig.„Ich betätige mich ja nicht politisch“, fügt eine Kollegin hinzu. Und das wollen die wenigsten. 80% der Leute interessierten sich nicht für Politik, meint sie, und die restlichen sind zwar da und dort skeptisch, aber sie wollen oder können sich nicht grundsätzlich oppositionell engagieren. Es gibt keine Plattform dafür und keine Tradition: Gesellschaftliche Organisation ausserhalb staatlicher Strukturen hat es in China nie gegeben, mit Ausnahme periodisch aufflackernder Geheimgesellschaften, die oft mit Unruhen in Verbindung gebracht werden und daher nicht positiv konnotiert sind.

Trittsicherer Löwe – zwei Akrobaten bewegen sich virtuos auf Säulen, um Kunden für ein Geschäft anzulocken
Beobachtung 2: Teilpolitiken (Baupolitik, Umweltpolitik) werden durchaus kontrovers diskutiert. Man darf einfach den Kaiser - die Partei(herrschaft) – nicht kritisieren und infrage stellen. Man ist es im übrigen seit Jahrtausenden gewohnt, gewisse Dinge hinzunehmen. Typisch die Bemerkung einer jungen Kollegin zu den Forderungen der Studenten in Hongkong nach offener demokratischer Wahl des Stadtchefs: Sie sei einverstanden, finde es aber nicht so wichtig; schliesslich würden die Hongkonger am Ende so oder so einen Chef haben, und sie könnten ja leben, wie sie wollen.
Natürlich, es gibt gute und schlechte Kaiser: In einer Klasse, mit der ich das bespreche, sind die Meinungen einhellig: Mao sehen sie nicht positiv, vor allem die Kulturrevolution nicht, Deng Xiao Ping hingegen geniesst einen sehr guten Ruf, und der aktuelle Staats- und Parteichef Xi Jinping ist äusserst beliebt. Schon nach zwei Jahren im Amt wird er von den Schülern mit seinem Spitznamen Onkel Xi bezeichnet. Seine Antikorruptionskampagne ebenso wie die neuen wirtschaftlichen Ziele inklusive Umweltschutz werden von allen Gesprächspartnern einhellig als positiv gewertet; es wird ihm ernsthaftes Engagement für die Bevölkerung attestiert.
Beobachtung 3: Überhaupt wird von vielen gewürdigt, dass die Behörden Anstrengungen für das Allgemeinwohl unternähmen, gerade zum Beispiel im Bereich der viel kritisierten Luftverschmutzung. Das Allgemeinwohl ist wichtiger als individuelle Menschenrechte. Dass einzelne unterdrückt, dass Meinungen zensuriert werden, ist für viele eine Nebensache. Wenn man danach fragt, so sagen die einen, sie vertrauten der Regierung, dass sie das Richtige mache, die andern meinen, sie seien wohl dagegen – aber sie könnten ja eh nichts dagegen machen, also regten sie sich lieber nicht auf.

Frau führt ihre zwei Hähne mit einem Kinderwagen im Park spazieren
Solche Haltungen trifft man auch bei Leuten, die sich durchaus individualistisch am Rand der Gesellschaft sehen. Ich möchte deshalb als letzte Beobachtung zwei solche jungen Menschen, die ich etwas näher kennenlernte, kurz beschreiben. Es geht dabei nicht mehr direkt um das Titel-Thema – indirekt aber sehr wohl.
Im einzigen italienischen Restaurant in Xian, wo man eine essbare Pizza bekommt, serviert chinesisches Personal. Auch die Gäste sind hauptsächlich Chinesen. Während alle vor und zwischen dem Essen auf ihre iPhones starren, lese ich in einem Gedichtband. Die junge Bedienung interessiert sich, was ich lese und ist ganz entzückt, dass ich Gedichte von Li Bai lese, einem der berühmtesten chinesischen Dichter aus der Tang-Zeit (8.Jh.). Den liebe sie sehr, er sei – ihr Englischwortschatz ist sehr knapp bemessen – so „talented“. Sie empfiehlt mir andere Dichter, alle mehr als tausend Jahre alt. Auf die Frage, ob sie diese Dichter aus der Schule kenne, antwortet sie: „Alle Chinesen kennen sie.“
Dass Jie, die junge Frau Mitte zwanzig, nicht ganz repräsentativ für die heutige chinesische Jugend sein dürfte, stellt sich heraus, als wir bei meinen nächsten Besuchen weiter ins Gespräch kommen. Immer interessiert es sie, was ich lese. Sie habe Biotechnik studiert, aber die Arbeit am Computer habe ihr nicht gefallen; die Arbeitskolleginnen hätten sich nur fürs Geldverdienen interessiert und wie sie zu einem wohlhabenden Mann kämen, aber keine Bücher gelesen. Deshalb arbeite sie lieber hier im Service Teilzeit – da könne sie wenigstens ihr Englisch verbessern, weil viele Ausländer hier verkehren, und sie habe so genügend Zeit zum Lesen. Nach einer unglücklichen Jugend als drittes, nicht erwünschtes Kind der Familie, habe sie eines Tages die Bücher lieben gelernt, in denen sie nach dem Sinn des Lebens suche.
Sie lese auch deutsche Schriftsteller in chinesischer Übersetzung, erzählt Li einmal und schreibt mir die Namen auf einen Zettel: Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Goethes Faust sei interessant, ob ich ihr weitere Bücher des 18. und 19. Jahrhunderts empfehlen könne. Sofort gibt sie die Schriftstellernamen hinter der Theke ein, um Übersetzungen zu suchen; leider habe sie nur Schiller gefunden, die andern nicht; der sei doch ein gutaussehender Mann, der früh gestorben und mit Goethe befreundet gewesen sei. Sie erbittet Ratschläge zum Lesen. Bei etlichen von mir empfohlenen Romanen – „the bigger the better“, meint sie – winkt sie allerdings ab: Tolstoi (Krieg und Frieden, Anna Karenina) kenne sie schon, bei Dostojewski sei sie grad an den Brüdern Karamasov.
Li arbeitet als Kellnerin, auch wenn das wenig Ansehen habe und man relativ wenig verdiene und die Eltern das missbilligten. Ihr Ziel – so erläutert sie in weiteren Gesprächen - sei ein ganz einfaches, unauffälliges Leben: wenig scheinen, viel sein - nach dem Vorbild einer Figur aus einem französischen Film bzw. Roman. Am Ende des Lebens möchte sie sich nicht sagen müssen, das Wichtigste verpasst zu haben. Sie schwärmt von europäischer Literatur und chinesischer Philosophie der Antike (Zhuangzi). Überhaupt ist ihr China wichtig, ins Ausland zu gehen, reizt sie nicht. Politik interessiert sie nicht, weder chinesische noch internationale. Nur Literatur, Philosophie und Geschichte.

In diesem Punkt unterscheidet sie sich von ihrem Kollegen und Freund Luo, der ihr sonst in vielem ähnlich ist. Ich habe die beiden zweimal zum Mittagessen in ein Restaurant eingeladen und mich mit ihnen unterhalten. Luo, der gut Englisch kann, fällt auf mit seinen langen, zu einem Rossschwanz gebundenen Haaren, was hier noch seltener ist als in Europa – das eben sei ein Stück seiner Freiheit, meint er schmunzelnd. Er lese Zeitung und informiere sich, ohne sich beteiligen zu wollen. Studierter Psychologe, arbeitet auch er als Kellner, weil ihm das viel Freiheit lasse – die Psychologie habe ihn eigentlich nur interessiert, um seine persönlichen Probleme zu verstehen, jetzt fände er sie langweilig. Wichtig ist ihm, so zu leben, wie er will – während des Studiums habe er Magengeschwüre gehabt, jetzt gehe es ihm gut. Was nachher komme – in China ist es nicht üblich, länger als bis dreissig im Service zu arbeiten – lasse er auf sich zukommen; man werde sehen, was es werde. Er kann sich auch vorstellen in Europa Philosophie zu studieren, wenn sich die Möglichkeit ergäbe.
Luo sieht die chinesische Entwicklung kritisch, überraschenderweise aus marxistischer Sicht. Er habe Marx mit Interesse gelesen und glaubt, niemand aus der Führung habe ihn gelesen oder verstanden. Die Diskrepanz zwischen der kommunistischen Etikette und der kapitalistischen Politik sei problematisch, zumal die Unterschiede zwischen Arm und Reich zunähmen. Das werde früher oder später zu Umwälzungen führen müssen; wann und wie, ob gewaltsame oder friedliche Revolution, das wisse er nicht. Er ist nicht politisch aktiv, würde sich aber auf die Seite einer solchen Revolution stellen. Er hält die sozialen Gegensätze für das wichtigere Problem von China als die fehlende Meinungs- und Pressefreiheit. Es sei ohnehin schwierig, zu urteilen und die Wahrheit zu erkennen. Es mache ihm schon so grosse Schwierigkeiten, vergangene Ereignisse wie Maos Politik oder das Tienanmen-Massaker von 1989 zu beurteilen, würden doch zum Beispiel seine Eltern und Grosseltern viel positiver über die 1960er Jahre berichten, als sie heute dargestellt würden. Es heisse etwa, es seien Millionen während des Grossen Sprungs nach vorn verhungert, aber niemand aus seiner Verwandtschaft habe so etwas beobachtet oder jemand gekannt, der verhungert sei. Was solle er da glauben? Deshalb freut er sich fast ein bisschen auf die seiner Ansicht nach kommende Revolution: so etwas selbst zu erleben, müsse interessant sein.
Für beide ist die Gestaltung ihres Lebens das Wichtigste; und sie fühlen sich darin nicht eingeschränkt in China – ausser ein Stück weit von ihren Eltern, zu denen sie aber auf Distanz gehen und von denen sie sich nichts sagen lassen. Deshalb denken sie auch nicht daran wegzugehen. Verschiedene Gegenden Chinas zu sehen hingegen ist Luo wichtig. Deshalb ist er im Sommer aus seiner Heimatstadt Shanghai nach Xian gekommen – er wollte den Norden kennenlernen. Ihre postmaterialistische Haltung, meinen die beiden, sei allerdings die Haltung einer Minderheit der chinesischen Jugend – sie halten sich in keiner Weise für repräsentativ, sie wollen es auch nicht sein.

Dies ist der letzte Eintrag. In ein paar Tagen reise ich nach Hause. An den Schluss möchte ich ein Bild der älteren Dame setzen, die jeden Tag ganz für sich allein in unserem Hof singt und tanzt, mit den Nachbarn plaudert und mich immer fröhlich grüsst.

Ich versuche im folgenden nicht eine politische Einschätzung der jetzigen Situation zu geben. Ich möchte hier auch nicht zu einer Kritik der westlichen Berichterstattung über China ausholen – obwohl ich mich manchmal schon gewundert habe: Am Tag, nachdem ich die grosse Freiluft-Weihnachtsfeier der Katholiken besucht habe und die ganze Innenstadt von feiernden Chinesen überfüllt war, las ich im SPIEGEL, die chinesische Führung wolle Weihnachten unterdrücken. Und jetzt Ende Januar berichten die meisten deutschsprachigen Zeitungen, dass der Smog in Chinas Städten unerträglich sei - hier in Xian ist aber gerade dieses Jahr das Gegenteil der Fall: seit drei Monaten fast immer schönes Wetter, an drei Vierteln der Tage scheint die Sonne; dass es viel schöner als üblich sei, sagen hier alle – ob wegen des milden Winters oder wegen der Massnahmen gegen die Luftverschmutzung, weiss niemand. Einmal mehr gilt es die Grösse des Landes zu bedenken. Wenn in irgendeiner ostchinesischen Stadt die Weihnachtsfeierlichkeiten behindert werden, so ist das nicht China, und wenn es in Peking Smog hat, so heisst das noch nicht, dass es überall so ist.
Keine politische Einschätzung also, nur ein paar Beobachtungen aus der Froschperspektive in einem der eher ärmeren Stadtteile einer chinesischen Grossstadt.
Beobachtung 1: Das chinesische Regime mischt sich wenig ins Alltagsleben der Bevölkerung ein. Alle Chinesinnen und Chinesen, die ich danach gefragt habe, sagten, sie fühlten sich frei in ihrer Lebensgestaltung; und das ist den meisten jüngeren Menschen wichtig.„Ich betätige mich ja nicht politisch“, fügt eine Kollegin hinzu. Und das wollen die wenigsten. 80% der Leute interessierten sich nicht für Politik, meint sie, und die restlichen sind zwar da und dort skeptisch, aber sie wollen oder können sich nicht grundsätzlich oppositionell engagieren. Es gibt keine Plattform dafür und keine Tradition: Gesellschaftliche Organisation ausserhalb staatlicher Strukturen hat es in China nie gegeben, mit Ausnahme periodisch aufflackernder Geheimgesellschaften, die oft mit Unruhen in Verbindung gebracht werden und daher nicht positiv konnotiert sind.

Trittsicherer Löwe – zwei Akrobaten bewegen sich virtuos auf Säulen, um Kunden für ein Geschäft anzulocken
Beobachtung 2: Teilpolitiken (Baupolitik, Umweltpolitik) werden durchaus kontrovers diskutiert. Man darf einfach den Kaiser - die Partei(herrschaft) – nicht kritisieren und infrage stellen. Man ist es im übrigen seit Jahrtausenden gewohnt, gewisse Dinge hinzunehmen. Typisch die Bemerkung einer jungen Kollegin zu den Forderungen der Studenten in Hongkong nach offener demokratischer Wahl des Stadtchefs: Sie sei einverstanden, finde es aber nicht so wichtig; schliesslich würden die Hongkonger am Ende so oder so einen Chef haben, und sie könnten ja leben, wie sie wollen.
Natürlich, es gibt gute und schlechte Kaiser: In einer Klasse, mit der ich das bespreche, sind die Meinungen einhellig: Mao sehen sie nicht positiv, vor allem die Kulturrevolution nicht, Deng Xiao Ping hingegen geniesst einen sehr guten Ruf, und der aktuelle Staats- und Parteichef Xi Jinping ist äusserst beliebt. Schon nach zwei Jahren im Amt wird er von den Schülern mit seinem Spitznamen Onkel Xi bezeichnet. Seine Antikorruptionskampagne ebenso wie die neuen wirtschaftlichen Ziele inklusive Umweltschutz werden von allen Gesprächspartnern einhellig als positiv gewertet; es wird ihm ernsthaftes Engagement für die Bevölkerung attestiert.
Beobachtung 3: Überhaupt wird von vielen gewürdigt, dass die Behörden Anstrengungen für das Allgemeinwohl unternähmen, gerade zum Beispiel im Bereich der viel kritisierten Luftverschmutzung. Das Allgemeinwohl ist wichtiger als individuelle Menschenrechte. Dass einzelne unterdrückt, dass Meinungen zensuriert werden, ist für viele eine Nebensache. Wenn man danach fragt, so sagen die einen, sie vertrauten der Regierung, dass sie das Richtige mache, die andern meinen, sie seien wohl dagegen – aber sie könnten ja eh nichts dagegen machen, also regten sie sich lieber nicht auf.

Frau führt ihre zwei Hähne mit einem Kinderwagen im Park spazieren
Solche Haltungen trifft man auch bei Leuten, die sich durchaus individualistisch am Rand der Gesellschaft sehen. Ich möchte deshalb als letzte Beobachtung zwei solche jungen Menschen, die ich etwas näher kennenlernte, kurz beschreiben. Es geht dabei nicht mehr direkt um das Titel-Thema – indirekt aber sehr wohl.
Im einzigen italienischen Restaurant in Xian, wo man eine essbare Pizza bekommt, serviert chinesisches Personal. Auch die Gäste sind hauptsächlich Chinesen. Während alle vor und zwischen dem Essen auf ihre iPhones starren, lese ich in einem Gedichtband. Die junge Bedienung interessiert sich, was ich lese und ist ganz entzückt, dass ich Gedichte von Li Bai lese, einem der berühmtesten chinesischen Dichter aus der Tang-Zeit (8.Jh.). Den liebe sie sehr, er sei – ihr Englischwortschatz ist sehr knapp bemessen – so „talented“. Sie empfiehlt mir andere Dichter, alle mehr als tausend Jahre alt. Auf die Frage, ob sie diese Dichter aus der Schule kenne, antwortet sie: „Alle Chinesen kennen sie.“
Dass Jie, die junge Frau Mitte zwanzig, nicht ganz repräsentativ für die heutige chinesische Jugend sein dürfte, stellt sich heraus, als wir bei meinen nächsten Besuchen weiter ins Gespräch kommen. Immer interessiert es sie, was ich lese. Sie habe Biotechnik studiert, aber die Arbeit am Computer habe ihr nicht gefallen; die Arbeitskolleginnen hätten sich nur fürs Geldverdienen interessiert und wie sie zu einem wohlhabenden Mann kämen, aber keine Bücher gelesen. Deshalb arbeite sie lieber hier im Service Teilzeit – da könne sie wenigstens ihr Englisch verbessern, weil viele Ausländer hier verkehren, und sie habe so genügend Zeit zum Lesen. Nach einer unglücklichen Jugend als drittes, nicht erwünschtes Kind der Familie, habe sie eines Tages die Bücher lieben gelernt, in denen sie nach dem Sinn des Lebens suche.
Sie lese auch deutsche Schriftsteller in chinesischer Übersetzung, erzählt Li einmal und schreibt mir die Namen auf einen Zettel: Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Goethes Faust sei interessant, ob ich ihr weitere Bücher des 18. und 19. Jahrhunderts empfehlen könne. Sofort gibt sie die Schriftstellernamen hinter der Theke ein, um Übersetzungen zu suchen; leider habe sie nur Schiller gefunden, die andern nicht; der sei doch ein gutaussehender Mann, der früh gestorben und mit Goethe befreundet gewesen sei. Sie erbittet Ratschläge zum Lesen. Bei etlichen von mir empfohlenen Romanen – „the bigger the better“, meint sie – winkt sie allerdings ab: Tolstoi (Krieg und Frieden, Anna Karenina) kenne sie schon, bei Dostojewski sei sie grad an den Brüdern Karamasov.
Li arbeitet als Kellnerin, auch wenn das wenig Ansehen habe und man relativ wenig verdiene und die Eltern das missbilligten. Ihr Ziel – so erläutert sie in weiteren Gesprächen - sei ein ganz einfaches, unauffälliges Leben: wenig scheinen, viel sein - nach dem Vorbild einer Figur aus einem französischen Film bzw. Roman. Am Ende des Lebens möchte sie sich nicht sagen müssen, das Wichtigste verpasst zu haben. Sie schwärmt von europäischer Literatur und chinesischer Philosophie der Antike (Zhuangzi). Überhaupt ist ihr China wichtig, ins Ausland zu gehen, reizt sie nicht. Politik interessiert sie nicht, weder chinesische noch internationale. Nur Literatur, Philosophie und Geschichte.

In diesem Punkt unterscheidet sie sich von ihrem Kollegen und Freund Luo, der ihr sonst in vielem ähnlich ist. Ich habe die beiden zweimal zum Mittagessen in ein Restaurant eingeladen und mich mit ihnen unterhalten. Luo, der gut Englisch kann, fällt auf mit seinen langen, zu einem Rossschwanz gebundenen Haaren, was hier noch seltener ist als in Europa – das eben sei ein Stück seiner Freiheit, meint er schmunzelnd. Er lese Zeitung und informiere sich, ohne sich beteiligen zu wollen. Studierter Psychologe, arbeitet auch er als Kellner, weil ihm das viel Freiheit lasse – die Psychologie habe ihn eigentlich nur interessiert, um seine persönlichen Probleme zu verstehen, jetzt fände er sie langweilig. Wichtig ist ihm, so zu leben, wie er will – während des Studiums habe er Magengeschwüre gehabt, jetzt gehe es ihm gut. Was nachher komme – in China ist es nicht üblich, länger als bis dreissig im Service zu arbeiten – lasse er auf sich zukommen; man werde sehen, was es werde. Er kann sich auch vorstellen in Europa Philosophie zu studieren, wenn sich die Möglichkeit ergäbe.
Luo sieht die chinesische Entwicklung kritisch, überraschenderweise aus marxistischer Sicht. Er habe Marx mit Interesse gelesen und glaubt, niemand aus der Führung habe ihn gelesen oder verstanden. Die Diskrepanz zwischen der kommunistischen Etikette und der kapitalistischen Politik sei problematisch, zumal die Unterschiede zwischen Arm und Reich zunähmen. Das werde früher oder später zu Umwälzungen führen müssen; wann und wie, ob gewaltsame oder friedliche Revolution, das wisse er nicht. Er ist nicht politisch aktiv, würde sich aber auf die Seite einer solchen Revolution stellen. Er hält die sozialen Gegensätze für das wichtigere Problem von China als die fehlende Meinungs- und Pressefreiheit. Es sei ohnehin schwierig, zu urteilen und die Wahrheit zu erkennen. Es mache ihm schon so grosse Schwierigkeiten, vergangene Ereignisse wie Maos Politik oder das Tienanmen-Massaker von 1989 zu beurteilen, würden doch zum Beispiel seine Eltern und Grosseltern viel positiver über die 1960er Jahre berichten, als sie heute dargestellt würden. Es heisse etwa, es seien Millionen während des Grossen Sprungs nach vorn verhungert, aber niemand aus seiner Verwandtschaft habe so etwas beobachtet oder jemand gekannt, der verhungert sei. Was solle er da glauben? Deshalb freut er sich fast ein bisschen auf die seiner Ansicht nach kommende Revolution: so etwas selbst zu erleben, müsse interessant sein.
Für beide ist die Gestaltung ihres Lebens das Wichtigste; und sie fühlen sich darin nicht eingeschränkt in China – ausser ein Stück weit von ihren Eltern, zu denen sie aber auf Distanz gehen und von denen sie sich nichts sagen lassen. Deshalb denken sie auch nicht daran wegzugehen. Verschiedene Gegenden Chinas zu sehen hingegen ist Luo wichtig. Deshalb ist er im Sommer aus seiner Heimatstadt Shanghai nach Xian gekommen – er wollte den Norden kennenlernen. Ihre postmaterialistische Haltung, meinen die beiden, sei allerdings die Haltung einer Minderheit der chinesischen Jugend – sie halten sich in keiner Weise für repräsentativ, sie wollen es auch nicht sein.

Dies ist der letzte Eintrag. In ein paar Tagen reise ich nach Hause. An den Schluss möchte ich ein Bild der älteren Dame setzen, die jeden Tag ganz für sich allein in unserem Hof singt und tanzt, mit den Nachbarn plaudert und mich immer fröhlich grüsst.
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 10. Januar 2015
Eine erstaunlich gelassene Gesellschaft
wernerbaumann, 16:20h
Mein China-Aufenthalt neigt sich dem Ende zu – Zeit, ein paar Erfahrungen zusammenzufassen. Hier ein paar Überlegungen zur Gesellschaft. Was für eine Gesellschaft erlebt man, wenn man ein halbes Jahr in einer typischen chinesischen Grossstadt – und das ist Xian – lebt?
Mein Eindruck: eine erstaunlich gelassene Gesellschaft. Erstaunlich deshalb, weil China sich in einer ungeheuren Transformation befindet, die sich zudem in vergleichsweise enormem Tempo vollzieht (ein grosser Teil der Bevölkerung von Xian z. B., das sieht und spürt man, wohnt noch nicht lange in der Stadt). Und doch erlebt man im Alltag wenig Konflikte, kaum Aggressivität. Man hat den Eindruck, da arbeite eine Gesellschaft teils zielstrebig und geschäftig, teils eher gemächlich daran, weiterzukommen, und viele scheinen den neuen, oft bescheidenen Wohlstand zu geniessen. Sie fühlen sich wenig eingeschränkt im täglichen Leben; wo Vorschriften als lästig erlebt werden, werden sie auch mal ignoriert (Verkehr, Rauchverbot), sonst ergibt man sich gelassen ins Unvermeidliche: dass seit den Terroranschlägen uiguischer Separatisten vor zwei Jahren jede Tasche in jeder U-Bahn-Station durch den Security-Scan muss – ist halt so.
Einschränkend ist freilich festzuhalten: Was ich erlebt habe, ist nicht „die“ chinesische Gesellschaft, wenn es denn so etwas überhaupt gibt. Ich habe eine Stadt in einem riesigen und vielfältigen Land erlebt, und ich habe ein paar Menschen von mehr als einer Milliarde kennengelernt – darunter weder die ärmsten noch die reichen, niemand aus der bestimmenden politischen Elite. Es ist ein Blick aus einer sehr eingeschränkten Perspektive, angereichert durch Lektüre.
Wo steht diese Gesellschaft im Modernisierungsprozess? Wie stark ist die konfuzianische Prägung noch? Ist die Gesellschaft auf dem Weg zur Individualisierung und damit auch ein Stück weit zur Verwestlichung? Oder bildet sich hier eine neue, chinesische Spielart der Moderne heraus? Mit diesen Fragen beschäftigen sich unzählige Bücher. Meine beschränkten Beobachtungen ergeben – natürlich – keine klare Antwort; je mehr Einblick man hat, desto mehr verschwimmen die Konturen.
Ausgangspunkt war die traditionelle konfuzianische Gesellschaft, die der Kommunismus nur teilweise verändert, aber nicht grundlegend umgeprägt hat. Die gesellschaftliche Textur war immer kollektiv, die Rechte des Einzelnen spielten immer eine untergeord-nete Rolle. Das heisst nicht, dass die Chinesen Herdenmenschen (gewesen) wären; die Psyche des Einzelnen war häufig durch den Daoismus geprägt, der durchaus Spielräume bietet: Wenn man z. B. die allseits verehrten Dichter der Tang-Dynastie liest – die vor weit mehr als tausend Jahren häufig in der damaligen Hauptstadt hier in Xian lebten -, kann man einen Grad von Individualisierung ausmachen, der die in unseren Gegenden damals bekannte Bandbreite weit überschreitet.
Die grundlegenden menschlichen Beziehungen, welche Konfuzius in der Unterordnung der Untertanen unter den Herrscher, der Frau unter den Mann und der Kinder unter die Eltern sah, waren seit der Revolution unterschiedlichen Veränderungen unterworfen. Während im politischen Bereich sozusagen einfach der Kaiser durch die Partei ersetzt wurde, erklärte eines der ersten Gesetze 1949 die Gleichberechtigung der Frau. In diesem Bereich sind denn wohl auch die grössten Veränderungen sichtbar. Frauen bewegen sich selbstbewusst allein auf den Strassen, auch nachts. Frauen verdienen für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn, arbeiten allerdings oft weniger und weniger in hohen Positionen, ein auch bei uns bekanntes Phänomen. Junge Frauen wollen auch nach der Heirat selbstverständlich arbeiten - auch die junge Lehramts-Praktikantin, mit der ich chinesische bzw. deutsche Aussprache übe, die sonst viel auf die Wünsche ihrer Eltern gibt; sie wolle doch nicht finanziell vom Mann abhängig sein.

Hochzeitsfest 2014
Beim Thema Heirat zeigen sich wohl die Veränderungen und die Bruchlinien der gesellschaftlichen Transformation am stärksten. Im Grundsatz sind die arrangierten Ehen vorbei und die Partnerwahl ebenso wie die Lebensführung dem einzelnen überlassen. Die Hochzeit – ich war an eine eingeladen - wird im westlich, hauptsächlich amerika-nisch inspirierten Stil gefeiert mit einem grossen Essen, in welches die Zeremonie ein-gebettet ist; dass in meinem Fall mehr als vierhundert Menschen aus den beiden Fami-lien eingeladen wurden, verweist auf die immer noch starke Einbettung in die Sippe.

Heiratsmarkt im Park
Dass eine Hochzeit überhaupt stattfindet, dafür gibt es allerdings grossen Druck, dem sich kaum jemand entziehen kann. Wenn der Sohn oder die Tochter Ende Zwanzig noch nicht verheiratet sind, werden nicht selten die Eltern aktiv auf dem Heiratsmarkt, not-falls wortwörtlich: Am Wochenende gibt es – wie im Volkspark Shanghai, nur nicht ganz so gross – auch in einem Park in Xian einen Heiratsmarkt. Besorgte Eltern suchen dort Ehepartner für ihr noch nicht verheirateten Kinder. Auf A-4-Blättern, an Seilen und an Hecken aufgehängt, sind die wichtigsten Daten aufgelistet: Alter, Grösse, Ausbildung, Arbeit, manchmal Gewicht und Einkommen. Fotos hat es praktisch nie, es geht hier um die harten Fakten. Die Kontakthandynummer wird weiteres klären können – es ist eh nicht anzunehmen, dass die Betreffenden heute noch den Eltern einfach folgen, schliess-lich ist die Zwangsverheiratung seit der kommunistischen Revolution verboten. Das Interesse ist gross: Hunderte meist ältere Menschen sind hier am Sonntag Nachmittag und studieren das Angebot, in welchem die 1980er Jahrgänge dominieren, also die Endzwanziger, Anfangdreissiger; teilweise deuten zahlreiche gleich gestaltete Blätter auf professionelle Vermittler, die sich hier auch tummeln.

Über die Erfolgsquote solcher Unternehmungen ist nichts bekannt. Anderseits nehmen die Scheidungen stark zu in China - das ist wieder ein Hinweis auf die zunehmende Individualisierung, die traditionelle (konfuzianische) Loyalitäten aushebelt. Bemerkbar macht diese sich natürlich vor allem im Verhältnis der Kinder zu ihren Eltern. War in der traditionellen Gesellschaft ein adoleszentes Ringen um Selbstbestimmung, wie es die abendländische Kultur seit Jahrhunderten prägt, kein Thema, und ein Generationenkonflikt undenkbar, so haben die Ein-Kind-Politik (die in den letzten Jahren gerade gelo-ckert wurde) und der wirtschaftlich-gesellschaftliche Wandel in den letzten Jahrzehnten gegenläufige Spuren hinterlassen.
So sagt ein 16-jähriger in der Deutschstunde: „Mein Traum ist, ein unkonventioneller Jugendlicher zu sein“ (keine Ahnung, wo er das Wort aufgeschnappt hat). Warum? Weil es cool sei. Einzelne Schüler/innen, meist Knaben tragen demonstrativ die Schuluniform nicht - auch wenn einer dafür eine Woche vom Unterricht ausgeschlossen wird: anschliessend trägt er sie in einer Tasche mit, er habe sie ja dabei. Aber die Ansichten überkreuzen sich: ebendieser Schüler, der wegen einer Freundschaft zu einer älteren Frau mit seinen Eltern über Kreuz ist, denkt gleichzeitig in Beziehungsfragen traditionalistisch und lehnt unverheiratetes Zusammenleben als un-moralisch ab, während ein Mitschüler darin kein Problem sieht, dafür im Gegensatz zu den andern die Ein-Kind-Familie als sinnvoll für China verteidigt,. In diesem Mischmasch der Ansichten kann man durchaus eine echte Individualisierung sehen.
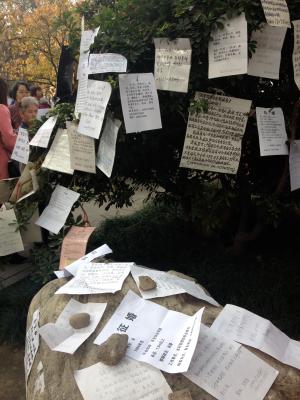
Natürlich gibt es auch hier verschiedene Szenen. „China today“ stellte im November 2014 die Wenyiqingnian (wörtl. Kultur- und Kunst-Jugend) vor, eine städtische Jugend „auf Identitätssuche zwischen Globalisierung und Individualität“. Sie zeichne sich aus durch Interesse für europäische Arthouse-Filme, Gedichte und Songtexte, Musik, Thea-ter, optisch durch Converse-Schuhe und Vintagelook. Kunst und Kultur dienten ihr als Gegenprogramm zur Kommerzialisierung. Sie lässt sich nieder in ruhigen Gassen („Stubenhocker“ nennt man sie auch), die „in“ werden und dann wieder von der Kommerzialisierung bedroht sind. Die Autorin folgert, „dass in China im Zusammenstoss mit der Globalisierung etwas Neues entstanden sein muss, etwas eigenes, das nicht nur Kopie oder Abklatsch der Kultur der Industrienationen ist“.
Symptomatisch ist sicher, dass in der nationalen „Maturprüfung“, der Gaokao, 2013 das Thema des Deutsch-Aufsatzes lautete: „Wir wollen nicht so sein wie unsere Eltern.“ Da ist vom Generationenkonflikt die Rede, der erläutert werden soll. Die Schülerinnen und Schüler der 12. Klasse, mit denen ich darüber rede, meinen, es sei nicht so arg bei ihnen; die eine sagt, sie habe vor ein paar Jahren viel mehr mit ihrer Mutter gestritten als jetzt. Die relativ junge Lehrerin hingegen sagt, sie selbst verstehe ihre Eltern nicht, die trotz genug Geld immer sparten und ihr Leben dafür aufopferten, ihr Enkelkind zu hüten – sie möchte das nicht so machen.
Auf der andern Seite kommt Antje Haag, deutsche Psychoanalytikerin mit langjähriger China-Erfahrung, in ihrem „Versuch über die moderne Seele Chinas“ (2013) zum Schluss, dass alle die enormen gesellschaftlichen Umwälzungen „dem konfuzianisch durchtränkten kulturellen Mutterboden nur wenig anhaben konnten“. Tatsächlich sind für die meisten Jugendlichen die Meinungen und Wünsche der Eltern sehr wichtig und bis mindestens zum Ende der Mittelschule bleiben sie kindlicher als bei uns, wohlbehütet, mit weniger Selbständigkeit – meinem Eindruck nach vor allem die Mädchen. Die biedere Unbeschwertheit der chinesischen (oder der hier sehr populären koreanischen) Popmusik drückt diese Befindlichkeit gar nicht so schlecht aus.

Am gleichen Strick ziehen, aber nicht in die gleiche Richtung: Hotelcrew beim Spass nach dem täglichen „Appell“
Sind die jungen Chinesen zum grossen Teil angepasste, denkfaule Wohlstandsprofiteure, wie mein südafrikanischer Kollege wettert, oder auf dem Weg, eine ganz eigene, mit dem konfuzianischen Gemeinschaftssinn verknüpfte Individualität zu entwickeln? Es gibt beide Tendenzen. Das traditionelle chinesische Selbst konnte sich in einer hierarchischen Gesellschaft beweglich verschiedenen Ansprüchen anpassen – so wie die chinesischen Schriftzeichen erst in Beziehung zu den andern Schriftzeichen ihren Sinn offenbaren. Wenn die jungen Chinesinnen und Chinesen diese Beweglichkeit im Zug der Modernisierung mit der Individualisierung verbinden lernen, dann kann vielleicht tatsächlich eine chinesisch geprägte moderne Gesellschaft entstehen, dann sind die Chinesen vielleicht als in besonderer Weise „flexible Menschen“ (R. Sennet) bestens gerüstet für die kommende Phase der Modernisierung. Das allerdings ist keine Erfahrung mehr, das ist Spekulation.
Mein Eindruck: eine erstaunlich gelassene Gesellschaft. Erstaunlich deshalb, weil China sich in einer ungeheuren Transformation befindet, die sich zudem in vergleichsweise enormem Tempo vollzieht (ein grosser Teil der Bevölkerung von Xian z. B., das sieht und spürt man, wohnt noch nicht lange in der Stadt). Und doch erlebt man im Alltag wenig Konflikte, kaum Aggressivität. Man hat den Eindruck, da arbeite eine Gesellschaft teils zielstrebig und geschäftig, teils eher gemächlich daran, weiterzukommen, und viele scheinen den neuen, oft bescheidenen Wohlstand zu geniessen. Sie fühlen sich wenig eingeschränkt im täglichen Leben; wo Vorschriften als lästig erlebt werden, werden sie auch mal ignoriert (Verkehr, Rauchverbot), sonst ergibt man sich gelassen ins Unvermeidliche: dass seit den Terroranschlägen uiguischer Separatisten vor zwei Jahren jede Tasche in jeder U-Bahn-Station durch den Security-Scan muss – ist halt so.
Einschränkend ist freilich festzuhalten: Was ich erlebt habe, ist nicht „die“ chinesische Gesellschaft, wenn es denn so etwas überhaupt gibt. Ich habe eine Stadt in einem riesigen und vielfältigen Land erlebt, und ich habe ein paar Menschen von mehr als einer Milliarde kennengelernt – darunter weder die ärmsten noch die reichen, niemand aus der bestimmenden politischen Elite. Es ist ein Blick aus einer sehr eingeschränkten Perspektive, angereichert durch Lektüre.
Wo steht diese Gesellschaft im Modernisierungsprozess? Wie stark ist die konfuzianische Prägung noch? Ist die Gesellschaft auf dem Weg zur Individualisierung und damit auch ein Stück weit zur Verwestlichung? Oder bildet sich hier eine neue, chinesische Spielart der Moderne heraus? Mit diesen Fragen beschäftigen sich unzählige Bücher. Meine beschränkten Beobachtungen ergeben – natürlich – keine klare Antwort; je mehr Einblick man hat, desto mehr verschwimmen die Konturen.
Ausgangspunkt war die traditionelle konfuzianische Gesellschaft, die der Kommunismus nur teilweise verändert, aber nicht grundlegend umgeprägt hat. Die gesellschaftliche Textur war immer kollektiv, die Rechte des Einzelnen spielten immer eine untergeord-nete Rolle. Das heisst nicht, dass die Chinesen Herdenmenschen (gewesen) wären; die Psyche des Einzelnen war häufig durch den Daoismus geprägt, der durchaus Spielräume bietet: Wenn man z. B. die allseits verehrten Dichter der Tang-Dynastie liest – die vor weit mehr als tausend Jahren häufig in der damaligen Hauptstadt hier in Xian lebten -, kann man einen Grad von Individualisierung ausmachen, der die in unseren Gegenden damals bekannte Bandbreite weit überschreitet.
Die grundlegenden menschlichen Beziehungen, welche Konfuzius in der Unterordnung der Untertanen unter den Herrscher, der Frau unter den Mann und der Kinder unter die Eltern sah, waren seit der Revolution unterschiedlichen Veränderungen unterworfen. Während im politischen Bereich sozusagen einfach der Kaiser durch die Partei ersetzt wurde, erklärte eines der ersten Gesetze 1949 die Gleichberechtigung der Frau. In diesem Bereich sind denn wohl auch die grössten Veränderungen sichtbar. Frauen bewegen sich selbstbewusst allein auf den Strassen, auch nachts. Frauen verdienen für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn, arbeiten allerdings oft weniger und weniger in hohen Positionen, ein auch bei uns bekanntes Phänomen. Junge Frauen wollen auch nach der Heirat selbstverständlich arbeiten - auch die junge Lehramts-Praktikantin, mit der ich chinesische bzw. deutsche Aussprache übe, die sonst viel auf die Wünsche ihrer Eltern gibt; sie wolle doch nicht finanziell vom Mann abhängig sein.

Hochzeitsfest 2014
Beim Thema Heirat zeigen sich wohl die Veränderungen und die Bruchlinien der gesellschaftlichen Transformation am stärksten. Im Grundsatz sind die arrangierten Ehen vorbei und die Partnerwahl ebenso wie die Lebensführung dem einzelnen überlassen. Die Hochzeit – ich war an eine eingeladen - wird im westlich, hauptsächlich amerika-nisch inspirierten Stil gefeiert mit einem grossen Essen, in welches die Zeremonie ein-gebettet ist; dass in meinem Fall mehr als vierhundert Menschen aus den beiden Fami-lien eingeladen wurden, verweist auf die immer noch starke Einbettung in die Sippe.

Heiratsmarkt im Park
Dass eine Hochzeit überhaupt stattfindet, dafür gibt es allerdings grossen Druck, dem sich kaum jemand entziehen kann. Wenn der Sohn oder die Tochter Ende Zwanzig noch nicht verheiratet sind, werden nicht selten die Eltern aktiv auf dem Heiratsmarkt, not-falls wortwörtlich: Am Wochenende gibt es – wie im Volkspark Shanghai, nur nicht ganz so gross – auch in einem Park in Xian einen Heiratsmarkt. Besorgte Eltern suchen dort Ehepartner für ihr noch nicht verheirateten Kinder. Auf A-4-Blättern, an Seilen und an Hecken aufgehängt, sind die wichtigsten Daten aufgelistet: Alter, Grösse, Ausbildung, Arbeit, manchmal Gewicht und Einkommen. Fotos hat es praktisch nie, es geht hier um die harten Fakten. Die Kontakthandynummer wird weiteres klären können – es ist eh nicht anzunehmen, dass die Betreffenden heute noch den Eltern einfach folgen, schliess-lich ist die Zwangsverheiratung seit der kommunistischen Revolution verboten. Das Interesse ist gross: Hunderte meist ältere Menschen sind hier am Sonntag Nachmittag und studieren das Angebot, in welchem die 1980er Jahrgänge dominieren, also die Endzwanziger, Anfangdreissiger; teilweise deuten zahlreiche gleich gestaltete Blätter auf professionelle Vermittler, die sich hier auch tummeln.

Über die Erfolgsquote solcher Unternehmungen ist nichts bekannt. Anderseits nehmen die Scheidungen stark zu in China - das ist wieder ein Hinweis auf die zunehmende Individualisierung, die traditionelle (konfuzianische) Loyalitäten aushebelt. Bemerkbar macht diese sich natürlich vor allem im Verhältnis der Kinder zu ihren Eltern. War in der traditionellen Gesellschaft ein adoleszentes Ringen um Selbstbestimmung, wie es die abendländische Kultur seit Jahrhunderten prägt, kein Thema, und ein Generationenkonflikt undenkbar, so haben die Ein-Kind-Politik (die in den letzten Jahren gerade gelo-ckert wurde) und der wirtschaftlich-gesellschaftliche Wandel in den letzten Jahrzehnten gegenläufige Spuren hinterlassen.
So sagt ein 16-jähriger in der Deutschstunde: „Mein Traum ist, ein unkonventioneller Jugendlicher zu sein“ (keine Ahnung, wo er das Wort aufgeschnappt hat). Warum? Weil es cool sei. Einzelne Schüler/innen, meist Knaben tragen demonstrativ die Schuluniform nicht - auch wenn einer dafür eine Woche vom Unterricht ausgeschlossen wird: anschliessend trägt er sie in einer Tasche mit, er habe sie ja dabei. Aber die Ansichten überkreuzen sich: ebendieser Schüler, der wegen einer Freundschaft zu einer älteren Frau mit seinen Eltern über Kreuz ist, denkt gleichzeitig in Beziehungsfragen traditionalistisch und lehnt unverheiratetes Zusammenleben als un-moralisch ab, während ein Mitschüler darin kein Problem sieht, dafür im Gegensatz zu den andern die Ein-Kind-Familie als sinnvoll für China verteidigt,. In diesem Mischmasch der Ansichten kann man durchaus eine echte Individualisierung sehen.
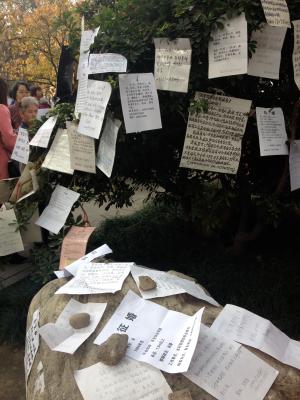
Natürlich gibt es auch hier verschiedene Szenen. „China today“ stellte im November 2014 die Wenyiqingnian (wörtl. Kultur- und Kunst-Jugend) vor, eine städtische Jugend „auf Identitätssuche zwischen Globalisierung und Individualität“. Sie zeichne sich aus durch Interesse für europäische Arthouse-Filme, Gedichte und Songtexte, Musik, Thea-ter, optisch durch Converse-Schuhe und Vintagelook. Kunst und Kultur dienten ihr als Gegenprogramm zur Kommerzialisierung. Sie lässt sich nieder in ruhigen Gassen („Stubenhocker“ nennt man sie auch), die „in“ werden und dann wieder von der Kommerzialisierung bedroht sind. Die Autorin folgert, „dass in China im Zusammenstoss mit der Globalisierung etwas Neues entstanden sein muss, etwas eigenes, das nicht nur Kopie oder Abklatsch der Kultur der Industrienationen ist“.
Symptomatisch ist sicher, dass in der nationalen „Maturprüfung“, der Gaokao, 2013 das Thema des Deutsch-Aufsatzes lautete: „Wir wollen nicht so sein wie unsere Eltern.“ Da ist vom Generationenkonflikt die Rede, der erläutert werden soll. Die Schülerinnen und Schüler der 12. Klasse, mit denen ich darüber rede, meinen, es sei nicht so arg bei ihnen; die eine sagt, sie habe vor ein paar Jahren viel mehr mit ihrer Mutter gestritten als jetzt. Die relativ junge Lehrerin hingegen sagt, sie selbst verstehe ihre Eltern nicht, die trotz genug Geld immer sparten und ihr Leben dafür aufopferten, ihr Enkelkind zu hüten – sie möchte das nicht so machen.
Auf der andern Seite kommt Antje Haag, deutsche Psychoanalytikerin mit langjähriger China-Erfahrung, in ihrem „Versuch über die moderne Seele Chinas“ (2013) zum Schluss, dass alle die enormen gesellschaftlichen Umwälzungen „dem konfuzianisch durchtränkten kulturellen Mutterboden nur wenig anhaben konnten“. Tatsächlich sind für die meisten Jugendlichen die Meinungen und Wünsche der Eltern sehr wichtig und bis mindestens zum Ende der Mittelschule bleiben sie kindlicher als bei uns, wohlbehütet, mit weniger Selbständigkeit – meinem Eindruck nach vor allem die Mädchen. Die biedere Unbeschwertheit der chinesischen (oder der hier sehr populären koreanischen) Popmusik drückt diese Befindlichkeit gar nicht so schlecht aus.

Am gleichen Strick ziehen, aber nicht in die gleiche Richtung: Hotelcrew beim Spass nach dem täglichen „Appell“
Sind die jungen Chinesen zum grossen Teil angepasste, denkfaule Wohlstandsprofiteure, wie mein südafrikanischer Kollege wettert, oder auf dem Weg, eine ganz eigene, mit dem konfuzianischen Gemeinschaftssinn verknüpfte Individualität zu entwickeln? Es gibt beide Tendenzen. Das traditionelle chinesische Selbst konnte sich in einer hierarchischen Gesellschaft beweglich verschiedenen Ansprüchen anpassen – so wie die chinesischen Schriftzeichen erst in Beziehung zu den andern Schriftzeichen ihren Sinn offenbaren. Wenn die jungen Chinesinnen und Chinesen diese Beweglichkeit im Zug der Modernisierung mit der Individualisierung verbinden lernen, dann kann vielleicht tatsächlich eine chinesisch geprägte moderne Gesellschaft entstehen, dann sind die Chinesen vielleicht als in besonderer Weise „flexible Menschen“ (R. Sennet) bestens gerüstet für die kommende Phase der Modernisierung. Das allerdings ist keine Erfahrung mehr, das ist Spekulation.
... link (0 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 25. Dezember 2014
Weihnachten als Dezember-Dekoration
wernerbaumann, 04:39h
Weihnachten ist unübersehbar in China. Spätestens Ende November tauchen die entsprechenden Dekorationen auf.

Auch kleinere Läden stellen hier im Dezember Weihnachtsbäume auf und bieten glänzende Girlanden feil. Die grossen Hotels und Warenhäuser treiben etwas mehr Aufwand und stellen auch das Musikprogramm entsprechend ein. So schallt einem jetzt auf der Strasse häufig „We wish you a merry Christmas“ entgegen, aber auch „Stille Nacht“ auf Chinesisch oder „Gingle bells“ auf Französisch kann es sein. Mehr noch aber dürften die Rabatt-Aktionen die Menschen in die Warenhäuser locken – Weihnachten ist hier unverhüllt, was es bei uns auch längst zum grössten Teil geworden ist: eine kommerzielle Angelegenheit. Im Zentrum von Xian gibt es sogar einen kleinen Weihnachtsmarkt, der sich stark am Standard-Design orientiert, wie es sich in den letzten Jahren in Europa durchgesetzt hat - verkauft werden nicht Kerzen u. ä., sondern normale Waren.

So wie bei uns der Valentinstag oder Halloween Einzug gehalten haben, so ist Weihnachten nach Asien gekommen. Weihnachten – das ist sozusagen die Dezember-Dekoration. Mit den Christen in China (20 Mio. nach offiziellen Angaben, 30 bis 80 Mio. nach Aussagen verschiedener christlicher Autoren) hat das nichts zu tun, auch nicht mit ihrem angeblich grossen Aufschwung, von dem hier wenig sicht- und spürbar ist. Zwar gibt es in Xian vier Kirchen, darunter auch eine hübsche alte Barockkirche, die an Lateinamerika erinnert – darin finden täglich zwei Gottesdienste statt, morgens und abends um 7 Uhr. Und natürlich gibt es am Heiligen Abend einen Weihnachtsgottesdienst. Auf dem dicht gefüllten Vorplatz wird von weiss gkleideten Priestern eine Messe gefeiert; ein recht gut singender Kirchenchor singt „Stille Nacht“ - alles auf Chinesisch.

Die alte Kirche am Nachmittag ...

... und am Heiligen Abend
Heiliger Abend – auch hier so genannt - ist aber in den letzten Jahren auch ein Volksfest für die Jugend geworden. Chinesische Auslandstudenten, die im Westen an Weihnachten gemeinsam Partys feierten, haben den Brauch in Chinas Städte gebracht und damit ein enormes Echo ausgelöst. Hier in Xian ist grosses Gedränge im Zentrum, viele Leute sind am Abend auf den Beinen, teilweise mit Kindern, vor allem aber die Jugend. Man bummelt, manche tragen Santaclaus-Mützen, manche glitzernde Halbmasken, die an den Karneval in Venedig erinnern, oder leuchtende Hasenohren oder Teufelshörner (!) - Partyaccessoires halt. Am 25. Dezember ist wieder normaler Arbeitstag, an meiner Schule z. B. ist grosser Semesterprüfungstag, weshalb die meisten Schüler am Abend vorher knurrend lernen.

Party um den wie immer beleuchteten Glockenturm im Zentrum
Ist die weihnachtliche Präsenz in China ein Hinweis auf dessen zunehmende Verwestlichung? Bedeutet die Modernisierung Verwestlichung? „The key to understanding Asian modernitiy, like Western modernity, lies not in the hardware, but in the software – the ways of relating, the values and beliefs, the customs, the institutions, the language, the rituals and festivals, the role oft he family“, schreibt der Engländer Martin Jacques in seinem bedeutenden Buch von 2009 „When China Rules the World“. Nichts spricht dafür, dass Weihnachten für die Chinesen eine tiefere Bedeutung hat, als dass man einfach globalisiert feiert; ihre Eltern wüssten gar nicht, was das sei, meint eine Kollegin. So wie bei Hochzeiten mittlerweile das westliche weisse Brautkleid Mode ist – daneben hat die Baut aber noch ein zweites, traditionell rotes, das sie im Verlauf des Festes anzieht – so hat man auch hier gewisse Formen übernommen, ohne dass damit auch der westliche Inhalt mitgemeint ist.
Die Orientierung am Westen scheint im übrigen in manchen Bereichen eher etwas rückläufig, und das nicht nur, weil der im Volk beliebte Staats- und Parteichef Xi Jinping das propagiert. So sieht man heute weniger westliche Models in der Werbung als vor ein paar Jahren. Wenn die Weihnachtsdekorationen dennoch populär zu sein scheinen (viele Passanten fotografieren sich davor), dann scheint mir das eher mit dem Hang der Chinesen zum Kitsch zu tun haben. Ähnlich wie in Italien, mit dessen Kultur China nicht nur die zentrale Bedeutung des Essens teilt, finden sich hier ein reiches kulturelles Erbe von exquisitem Geschmack ebenso wie ein Sinn für Eleganz bei wachsenden Teilen der Bevölkerung neben und gleichzeitig mit erbärmlichem Kitsch in allen Bereichen. Besonders dem Hang zu glitzernden Lichtern, der sowohl an der nächtlich beleuchteten Stadtmauer wie an vielen Hochhäusern ausgelebt wird, kommen Weihnachtsdekorationen natürlich sehr entgegen. Mit Weihnachten kommt also – in Jacques’ Worten – keine neue Software nach China, die Hardware wird lediglich für ein paar Wochen neu dekoriert.


Auch kleinere Läden stellen hier im Dezember Weihnachtsbäume auf und bieten glänzende Girlanden feil. Die grossen Hotels und Warenhäuser treiben etwas mehr Aufwand und stellen auch das Musikprogramm entsprechend ein. So schallt einem jetzt auf der Strasse häufig „We wish you a merry Christmas“ entgegen, aber auch „Stille Nacht“ auf Chinesisch oder „Gingle bells“ auf Französisch kann es sein. Mehr noch aber dürften die Rabatt-Aktionen die Menschen in die Warenhäuser locken – Weihnachten ist hier unverhüllt, was es bei uns auch längst zum grössten Teil geworden ist: eine kommerzielle Angelegenheit. Im Zentrum von Xian gibt es sogar einen kleinen Weihnachtsmarkt, der sich stark am Standard-Design orientiert, wie es sich in den letzten Jahren in Europa durchgesetzt hat - verkauft werden nicht Kerzen u. ä., sondern normale Waren.

So wie bei uns der Valentinstag oder Halloween Einzug gehalten haben, so ist Weihnachten nach Asien gekommen. Weihnachten – das ist sozusagen die Dezember-Dekoration. Mit den Christen in China (20 Mio. nach offiziellen Angaben, 30 bis 80 Mio. nach Aussagen verschiedener christlicher Autoren) hat das nichts zu tun, auch nicht mit ihrem angeblich grossen Aufschwung, von dem hier wenig sicht- und spürbar ist. Zwar gibt es in Xian vier Kirchen, darunter auch eine hübsche alte Barockkirche, die an Lateinamerika erinnert – darin finden täglich zwei Gottesdienste statt, morgens und abends um 7 Uhr. Und natürlich gibt es am Heiligen Abend einen Weihnachtsgottesdienst. Auf dem dicht gefüllten Vorplatz wird von weiss gkleideten Priestern eine Messe gefeiert; ein recht gut singender Kirchenchor singt „Stille Nacht“ - alles auf Chinesisch.

Die alte Kirche am Nachmittag ...

... und am Heiligen Abend
Heiliger Abend – auch hier so genannt - ist aber in den letzten Jahren auch ein Volksfest für die Jugend geworden. Chinesische Auslandstudenten, die im Westen an Weihnachten gemeinsam Partys feierten, haben den Brauch in Chinas Städte gebracht und damit ein enormes Echo ausgelöst. Hier in Xian ist grosses Gedränge im Zentrum, viele Leute sind am Abend auf den Beinen, teilweise mit Kindern, vor allem aber die Jugend. Man bummelt, manche tragen Santaclaus-Mützen, manche glitzernde Halbmasken, die an den Karneval in Venedig erinnern, oder leuchtende Hasenohren oder Teufelshörner (!) - Partyaccessoires halt. Am 25. Dezember ist wieder normaler Arbeitstag, an meiner Schule z. B. ist grosser Semesterprüfungstag, weshalb die meisten Schüler am Abend vorher knurrend lernen.

Party um den wie immer beleuchteten Glockenturm im Zentrum
Ist die weihnachtliche Präsenz in China ein Hinweis auf dessen zunehmende Verwestlichung? Bedeutet die Modernisierung Verwestlichung? „The key to understanding Asian modernitiy, like Western modernity, lies not in the hardware, but in the software – the ways of relating, the values and beliefs, the customs, the institutions, the language, the rituals and festivals, the role oft he family“, schreibt der Engländer Martin Jacques in seinem bedeutenden Buch von 2009 „When China Rules the World“. Nichts spricht dafür, dass Weihnachten für die Chinesen eine tiefere Bedeutung hat, als dass man einfach globalisiert feiert; ihre Eltern wüssten gar nicht, was das sei, meint eine Kollegin. So wie bei Hochzeiten mittlerweile das westliche weisse Brautkleid Mode ist – daneben hat die Baut aber noch ein zweites, traditionell rotes, das sie im Verlauf des Festes anzieht – so hat man auch hier gewisse Formen übernommen, ohne dass damit auch der westliche Inhalt mitgemeint ist.
Die Orientierung am Westen scheint im übrigen in manchen Bereichen eher etwas rückläufig, und das nicht nur, weil der im Volk beliebte Staats- und Parteichef Xi Jinping das propagiert. So sieht man heute weniger westliche Models in der Werbung als vor ein paar Jahren. Wenn die Weihnachtsdekorationen dennoch populär zu sein scheinen (viele Passanten fotografieren sich davor), dann scheint mir das eher mit dem Hang der Chinesen zum Kitsch zu tun haben. Ähnlich wie in Italien, mit dessen Kultur China nicht nur die zentrale Bedeutung des Essens teilt, finden sich hier ein reiches kulturelles Erbe von exquisitem Geschmack ebenso wie ein Sinn für Eleganz bei wachsenden Teilen der Bevölkerung neben und gleichzeitig mit erbärmlichem Kitsch in allen Bereichen. Besonders dem Hang zu glitzernden Lichtern, der sowohl an der nächtlich beleuchteten Stadtmauer wie an vielen Hochhäusern ausgelebt wird, kommen Weihnachtsdekorationen natürlich sehr entgegen. Mit Weihnachten kommt also – in Jacques’ Worten – keine neue Software nach China, die Hardware wird lediglich für ein paar Wochen neu dekoriert.

... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 3. Dezember 2014
Disziplin?
wernerbaumann, 14:44h
Chinesen gelten als fleissig und diszipliniert bei der Arbeit und in der Schule. Aus der Nähe betrachtet bestätigt sich das Klischee nicht immer.
Im Alltag gibt es viele Bereiche, die tadellos genau und pünktlich funktionieren, wo also auch sehr viel Disziplin gefordert werden muss.Der Superschnellzug von Peking nach Shanghai z. B. fuhr gar eine Minute vor der Abfahrtszeit ab – wehe den knappen Fahrgästen. Im Strassenverkehr hingegen – ich habe es schon andernorts beschrieben – sind die Regeln ein unverbindlicher Rahmen, in dem sich die Stärkeren durchsetzen, die Schwächeren dafür umso unbekümmerter machen, was sie wollen. Polizisten und andere Verkehrsregler reagieren mit Pfeifen und allenfalls Schreien, weitere Konsequenzen haben die Regelverletzungen nicht. Mit Lautsprecheraufrufen wird in der U-Bahn versucht, diszipliniertes Verhalten zu erzeugen - der Erfolg ist mässig. Selten sieht man Schilder gegen das Spucken wie im Bahnhof von Wuhan (Bild unten) – auf der Strasse aber spucken Männer immer noch lautstark; es löst so wenig Reaktionen aus, wie wenn eine Mutter ihr Kleinkind in der U-Bahnstation auf den Boden pinkeln lässt – schliesslich sind die Kleinkinderhosen dafür unten offen. Kurz, im Alltag funktioniert China eher chaotisch, und alte dörfliche Verhaltensweisen mischen sich mit modernen.

In der Schule ist das nicht anders. Einerseits sind die Schülerinnen und Schüler immer pünktlich anwesend. Die Disziplin während der Stunde ist allerdings – wie überall – sehr unterschiedlich von Klasse zu Klasse und auch innerhalb der Klassen. Da wird auch viel zwischendurch geredet, und auch ziemlich laut, so dass der Geräuschpegel manchmal die Stimmen der Sprechenden verschluckt. Wer müde ist, legt den Kopf auf den Tisch; vor allem in der Mittelstufe (7.-9. Schuljahr) gibt es einzelne, die praktisch gar nicht aufpassen und nichts mitbekommen. Die Lehrerinnen und Lehrer reagieren darauf eher sanft. Zwar sieht man ab und zu Schüler, die an die Rückwand des Zimmers oder aus dem Zimmer auf den Gang geschickt werden, wo sie stehend warten müssen, und wer die Hausaufgaben schlecht macht, wird zurechtgewiesen, aber harte disziplinarische Sanktionen scheinen selten. Es werden zwar Anforderungen gestellt, Hausaufgaben erteilt und immer korrigiert und bewertet – diszipliniertes Verhalten hat nicht oberste Priorität.
Die Schule versucht, eine gewisse moralische und verhaltensbezogene Erziehung zu vermitteln. So heisst es im Gang:

Und diese Woche werden auf Tafeln vor dem Schulhaus einerseits (positiv!) Bilder von erfolgreichen Auslandaufenthalten von Schülerinnen und Schülern der Schule gezeigt ...

... anderseits (negativ!) aber auch mit zahlreichen Fotos der letzten Tage Verstösse gegen die Regeln angeprangert, welche ein schlechtes Bild der Schule abgeben:


Littering im Klassenzimmer ...

Nicht- oder nichtkorrektes Tragen der Schuluniform ...
...oder Essen ins Schulhaus bringen etc. Ob das etwas bringt? Zweifel sind angebracht. Einer meiner Schüler der 11. Klasse, der die Schuluniform nie trägt und deshalb eine Woche vom Unterricht ausgeschlossen wurde, kommt auch nachher im gleichen, eher eleganten Outfit wie vorher. Auf meine Frage, wie das jetzt sei mit der Uniform, grinst er: „Ich mag das nicht“ und verweist auf eine Tasche, die er bei sich hat - da drin sei sie, er habe sie ja dabei.
Die Elite der chinesischen Jugend mag strebsam, ungeheuer fleissig und diszipliniert sein, die grosse Masse scheint, wie bei uns, manches zunehmend locker zu sehen.
Im Alltag gibt es viele Bereiche, die tadellos genau und pünktlich funktionieren, wo also auch sehr viel Disziplin gefordert werden muss.Der Superschnellzug von Peking nach Shanghai z. B. fuhr gar eine Minute vor der Abfahrtszeit ab – wehe den knappen Fahrgästen. Im Strassenverkehr hingegen – ich habe es schon andernorts beschrieben – sind die Regeln ein unverbindlicher Rahmen, in dem sich die Stärkeren durchsetzen, die Schwächeren dafür umso unbekümmerter machen, was sie wollen. Polizisten und andere Verkehrsregler reagieren mit Pfeifen und allenfalls Schreien, weitere Konsequenzen haben die Regelverletzungen nicht. Mit Lautsprecheraufrufen wird in der U-Bahn versucht, diszipliniertes Verhalten zu erzeugen - der Erfolg ist mässig. Selten sieht man Schilder gegen das Spucken wie im Bahnhof von Wuhan (Bild unten) – auf der Strasse aber spucken Männer immer noch lautstark; es löst so wenig Reaktionen aus, wie wenn eine Mutter ihr Kleinkind in der U-Bahnstation auf den Boden pinkeln lässt – schliesslich sind die Kleinkinderhosen dafür unten offen. Kurz, im Alltag funktioniert China eher chaotisch, und alte dörfliche Verhaltensweisen mischen sich mit modernen.

In der Schule ist das nicht anders. Einerseits sind die Schülerinnen und Schüler immer pünktlich anwesend. Die Disziplin während der Stunde ist allerdings – wie überall – sehr unterschiedlich von Klasse zu Klasse und auch innerhalb der Klassen. Da wird auch viel zwischendurch geredet, und auch ziemlich laut, so dass der Geräuschpegel manchmal die Stimmen der Sprechenden verschluckt. Wer müde ist, legt den Kopf auf den Tisch; vor allem in der Mittelstufe (7.-9. Schuljahr) gibt es einzelne, die praktisch gar nicht aufpassen und nichts mitbekommen. Die Lehrerinnen und Lehrer reagieren darauf eher sanft. Zwar sieht man ab und zu Schüler, die an die Rückwand des Zimmers oder aus dem Zimmer auf den Gang geschickt werden, wo sie stehend warten müssen, und wer die Hausaufgaben schlecht macht, wird zurechtgewiesen, aber harte disziplinarische Sanktionen scheinen selten. Es werden zwar Anforderungen gestellt, Hausaufgaben erteilt und immer korrigiert und bewertet – diszipliniertes Verhalten hat nicht oberste Priorität.
Die Schule versucht, eine gewisse moralische und verhaltensbezogene Erziehung zu vermitteln. So heisst es im Gang:

Und diese Woche werden auf Tafeln vor dem Schulhaus einerseits (positiv!) Bilder von erfolgreichen Auslandaufenthalten von Schülerinnen und Schülern der Schule gezeigt ...

... anderseits (negativ!) aber auch mit zahlreichen Fotos der letzten Tage Verstösse gegen die Regeln angeprangert, welche ein schlechtes Bild der Schule abgeben:


Littering im Klassenzimmer ...

Nicht- oder nichtkorrektes Tragen der Schuluniform ...
...oder Essen ins Schulhaus bringen etc. Ob das etwas bringt? Zweifel sind angebracht. Einer meiner Schüler der 11. Klasse, der die Schuluniform nie trägt und deshalb eine Woche vom Unterricht ausgeschlossen wurde, kommt auch nachher im gleichen, eher eleganten Outfit wie vorher. Auf meine Frage, wie das jetzt sei mit der Uniform, grinst er: „Ich mag das nicht“ und verweist auf eine Tasche, die er bei sich hat - da drin sei sie, er habe sie ja dabei.
Die Elite der chinesischen Jugend mag strebsam, ungeheuer fleissig und diszipliniert sein, die grosse Masse scheint, wie bei uns, manches zunehmend locker zu sehen.
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 22. November 2014
Um- und Neubau der Stadt
wernerbaumann, 06:03h

Blick aus meinem Fenster: Im Vordergrund ältere, dahinter neue Bauten (vorne rechts ein Wohnblock wie der, in dem ich wohne)
Die chinesischen Städte werden in raschem Tempo um- und neugebaut, hauptsächlich in die Höhe. Die Hälfte der Häuser der 22-Millionen-Stadt Shanghai stamme aus den letzten zehn Jahren, heisst es. In Xian geht es nicht ganz so rasant, aber überall wird auch hier gebaut. China, wo immer noch gut die Hälfte der riesigen Bevölkerung auf dem Land wohnt, ist durch die wirtschaftliche Entwicklung in einem starken Urbanisierungsprozess begriffen. Von 2010-25 werden über 300 Mio. Menschen – das entspricht etwa der Bevölkerung der USA - in die Städte ziehen, rechnet man. Dafür wird gebaut wie wild, in den Städten und am Rand der Städte.
Unzählige Hochhäuser sind im Bau in Xian: Am Rand der Stadt wachsen die Quartiere, es entstehen aber auch einzelne Satellitenstädte recht weit entfernt vom Zentrum. Auch Universitäten – es gibt in Xian etwa hundert Hochschulen - verlagern zum Teil ihren Campus aufs Land, weil sie in der Stadt zu wenig Platz haben: Etwa eine Busstunde südlich der Stadt, am Rand der Berge, stehen zahlreiche grosse neue Universitätsbauten, z. T. mit Studentenwohnhäusern. Die Busse dahin sind morgens und abends proppenvoll.

Sehr verdichtetes Bauen
Viele der neuen Wohnhochhäuseram Stadtrand stehen leer; der Bedarf ist zwar mittelfristig sicher gegeben, aber viele Chinesen können sich den Preis einer neuen Wohnung nicht leisten. Es ist deshalb immer wieder von einer drohenden Immobilienblase die Rede in der westlichen Presse – die Mehrheit der Beobachter glaubt aber, dass die chinesische Regierung rechtzeitig intervenieren würde.
Auch mitten in der Stadt gibt es riesige Baustellen.Ganze Quartiere werden abgerissen und stehen zum Teil dann doch noch recht lange Zeit zur Rest- und Zwischennutzung zur Verfügung. In meinem Quartier gibt es mehrere solche Abrissflächen. Die eine ist von einer alten Quartiermauer umgeben und deshalb leer;die andere, ein riesiges Areal, auf dem gemäss Plakat eine Siedlung namens King Side entstehen soll, ist offen.In den Bauruinen gibt es noch kleine Geschäfte und Handwerker, in Zelten haben sich Händler und ein improvisiertes Restaurant etabliert, und mehrere Altstoffsammler und -händler haben sich auf dem Gelände niedergelassen, durch welches sich quer eine holprige Piste schlängelt, auf der Autos, Scooter und Fussgänger unterwegs sind zu den älteren Wohnblocks am anderen Ende des Gevierts.

Vorher ...

... dazwischen ...

... nachher
Wo irgendwo ein Platz frei ist, eröffnet jemand ein Geschäft. Was legal ist und was nicht, ist schwer zu beurteilen. Die zahlreichen Strassenhändler und fliegenden Essensverkäufer, die seit Monaten manchmal das Trottoir in meiner Strasse fast unpassierbar machen, sind plötzlich verschwunden – vermutlich habe die Stadtverwaltung sie wegen Illegalität geräumt, wird vermutet. Zwei Wochen später erscheinen die ersten wieder.
Wird die Vitalität dieser Gesellschaft in den Neubauvierteln mit den meist 20-bis 30-stöckigen Hochhäusern verloren gehen? Schwer zu sagen. Bei den Satellitenstädten weit draussen und bisher ohne genügenden ÖV-Anschluss kann man sich pulsierendes Leben schwer vorstellen.

Bei den Vierteln in der Stadt ist schon von der Konzeption her ein Stück traditionelles Strassenleben berücksichtigt: Der Strasse entlang gibt es meist ein Sockelgeschoss für die unzähligen kleinen Geschäfte und Restaurants, wie es sie in den traditionellen Strassen gibt. Teils sind sie in den neuen Siedlungen gut belegt, teils stehen sie (noch?) leer. Und schliesslich gibt es noch die von aussen nicht sichtbare Möglichkeit, das bisherige Strassenleben im Hochhaus auch in die Vertikale zu kippen. So berichtet ein Bekannter, der vorher in einem Hochhaus wohnte, dass dort mehrere Bewohner in ihren Wohnungen Restaurants eröffnet hätten, so dass die in den Büros in den unteren Stockwerken Beschäftigten mit dem Lift essen gehen konnten – eine Interpretation des Hochhauses, die zwar durchaus im Sinn Le Corbusiers, aber wohl nicht unbedingt der chinesischen Behörden ist.
Was geht sonst verloren beim Abriss der alten Quartiere? Wenig wirklich alte Bausubstanz, die gibt es kaum. Der Grossteil auch der alten Quartiere scheint nicht sehr alt, die Umschlagzeiten für Bauten waren in China immer relativ kurz. Die Holzbauten mussten sowieso von Zeit zu Zeit erneuert werden, aber auch die meisten Steinbauten sind neueren Datums. Zwar gibt es in den ein- bis zweistöckigen alten Vierteln durchaus so etwas wie den Charme, den arme Viertel überall haben können, den Anforderungen an ein bequemes Leben können die Häuser aber kaum genügen. Vergleichbare Quartiere zu den Pekinger Hutongs, deren Restbestände jetzt renoviert werden, habe ich bis jetzt hier keine gesehen. Entscheidend für die Lebensqualität in Zukunft wird also sein, ob die Leute sich eine neue Wohnung leisten können und wie das soziale Leben dann aussehen wird. Ebenso wichtig wird die Lösung der Verkehrsprobleme sein; der Ausbau der U-Bahn dürfte hier die Hauptrolle spielen.

Auch dieses Quartier ist wohl ...

... dem Abbruch geweiht
Die neuen Hochhäuser sind in der Regel weder besonders schön noch besonders hässlich, die chinesischen Accessoires wie geschweifte Ziegeldächer über dem 25. Stock sind aus der Mode gekommen, da und dort gibt es postmodernen Schickschnack, meist dominiert schlichte Funktionalität. Eine Sehnsucht nach traditioneller Architektur (oder das Schielen nach Touristen?) befördert anderseits in vielen chinesischen Städten die „Rekonstruktion“ oder „Renovation“ von historischen Vierteln – die beiden Begriffe werden nicht genau unterschieden, meist ist es wohl weder das eine noch das andere, sondern ein modernes Viertel in altem Gewand. Man kann das in der sog. Pekinger Altstadt, im französischen Viertel von Shanghai oder hier in der Nähe des Südtors sehen, wo Papier- und Pinsel-Händler ihre Waren verkaufen in der Nähe des beeindruckenden Stelen-Museums, wo seit Jahrhunderten chinesische Klassiker, eingeritzt in Steinstelen, aufbewahrt werden. Ergänzend zur Hochhauskultur werden solche Viertel wohl vermehrt eine Rolle spielen, der Platzmangel wird aber die weitere Verdichtung in die Höhe erzwingen.

Das Viertel ist rekonstruiert ...

... der Papierladen aber ist ganz echt.
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 8. November 2014
Deutsch lernen
wernerbaumann, 06:38h
Kann man an einer Mittelschule in China überhaupt Deutsch lernen? Immer wieder fragen mich das auch Chinesen erstaunt, wenn ich erzähle, dass ich hier Deutsch unterrichte. Deutsch lernen ist in China relativ populär, aber normalerweise an der Uni. Man lernt es nebenbei als Freifach, manche studieren es auch als Hauptfach, offenbar sogar eher zu viele. Eine junge Deutschlehrerin erzählt, dass zwei ihrer Studienkolleginnen ihr Deutsch gar nicht brauchen könnten, weil es in Xian zu wenig deutsche Firmen habe. Bei einer deutschen Firma arbeiten – das kann ein Motiv sein, um Deutsch zu lernen, Lehrer(in) sein ein anderes: „Ich liebe diese Sprache einfach“, sagt eine Kollegin. Meine Schüler nennen als Motiv das Interesse für das Land und die Kultur, die Wichtigkeit der deutschen Industrie und Technik (vor allem die deutschen Autos stehen in China hoch im Kurs), manche möchten auch gern in Deutschland studieren.
Deutsch lernen an der Mittelschule also. Meine Schule, die Xian Foreign Language School, hat Fremdsprachen als Schwerpunkt. Englisch beginnt schon in der Primarschule, in der Sekundarstufe I (7. - 9. Klasse) kommt eine zweite Fremdsprache dazu: Japanisch, Spanisch, Französisch oder Deutsch (3 oder 4 Lektionen pro Woche). Ab der 10. Klasse konzentrieren sich die Schüler wieder auf eine Fremdsprache: Englisch oder eine der genannten, die man auch dann noch neu anfangen kann (in dem Fall intensiv mit 10 Lektionen pro Woche). Diese Fremdsprache wird an der grossen nationalen Abschlussprüfung am Ende der 12. Klasse als eines von fünf Fächern geprüft.Es ist natürlich eine Minderheit, die Deutsch lernt, ebenso wie Französisch und Spanisch; am beliebtesten ist Englisch, es gilt auch als leichter - wie Japanisch, von dem man viele Zeichen schon kennt.
Fremdsprachenunterricht ist langsames, oft mühsames Bohren dicker Bretter, auch und gerade ich China, dessen Sprache in vielem so anders ist. Chinesische Schüler kämpfen vor allem mit der Aussprache von Lauten, die es in ihrer Sprache nicht gibt – manche versteht man noch nach Jahren Deutschunterricht schlecht – und natürlich mit der Grammatik: Deutsch zu lernen, wenn man in der eigenen Sprache weder Artikel noch Pluralformen, weder Deklination noch Konjugation kennt, ist harte Arbeit. Umso verwunderlicher ist es, wie schnell einzelne Schülerinnen und Schüler vorankommen – es gibt aber auch die, welche nach Jahren noch keinen geraden Satz aufs Papier, geschweige denn über die Lippen kriegen.

Moderner Unterricht: Partnerarbeit – die Lehrerin am Rand
Methodisch ist der Fremdsprachenunterricht durchaus auf der Höhe der Zeit. In Deutsch braucht man Bücher, die in Deutschland konzipiert wurden und arbeitet mit dem Goethe-Institut zusammen; die Methodik sieht zahlreiche verschiedene Aktivitäten für Hören, Lesen, Verstehen, Schreiben vor, auch Partner- und Gruppenarbeiten gibt es. Daneben sind auch ältere chinesische Methoden wie das Wiederholen im Chor und das Auswendiglernen verbreitet – in grossen Klassen die einzige Möglichkeit, damit alle üben; vor allem Englischklassen hört man häufig im Chor dem Tonband oder der Lehrerin nachsprechen. Der Nachteil dieser Methode: Schwächere Schülerinnen und Schüler können so unerkannt mitschwimmen, die Kluft zwischen Guten und Schwachen wird schnell sehr gross. Auch typisch chinesisch scheint mir, dass das Buch zentral ist: es wird vor- und rückwärts gelernt und repetiert. Was nicht im Buch vorkommt, ist im Moment interessant, wird aber nur von den Besten vielleicht memoriert.
Die Schule ist bestrebt, möglichst in jeder Sprache einen Muttersprachler für Konversationsstunden, aber auch als Auskunftsperson für die chinesischen Sprachlehrpersonen zu beschäftigen. So gibt es neben mir einen älteren Japaner, der für ein Jahr hierher gekommen ist und sich täglich selbst japanisches Essen zubereitet, weil er das Chinesische nicht vertrage (zu viel Fleisch!). Andere leben schon länger in China, sind aber neu an der Schule: ein junger Franzose, der gerade eine Chinesin geheiratet hat , ausgebildeter Ökonom, der parallel eine Dissertation schreibt; ein junger Spanier, der mit seiner Freundin hier lebt, und ein Südafrikaner, ebenfalls verheiratet mit einer Chinesin – er hält das chinesische Erziehungswesen für zu stark aufs Auswendiglernen und zu wenig aufs Denken ausgerichtet; wenn seine Kinder, die jetzt in der Primarschule sind, ins Mittelstufenalter kämen, werde er in ein anderes Land ziehen. Die Schwierigkeit mit der Konversation im Unterricht ist neben der sprachlichen Barriere eine gewisse Schüchternheit– die Hemmungen zu reden sind bei vielen gross – nicht nur im Unterricht.
Ein junger Mann spricht mich in der Warteschlange im Supermarkt an. Ob ich Amerikaner sei. Sein Englisch ist gut verständlich. Wir kommen ins Gespräch. Es stellt sich heraus, dass er in Xian Betriebswirtschaft studiert und vor kurzem das Studium abgeschlossen hat, seit kurzem arbeitet er. Wir sind auf der Strasse angelangt, er bedankt sich, er sei emotional sehr bewegt. Zum ersten Mal habe er einen Ausländer angesprochen – er habe sich das schon so oft gewünscht, aber nie getraut, weil er sein Englisch für zu schlecht halte – und dass daraus ein Gespräch geworden sei, mache ihn sehr glücklich.Auf der andern Seite wird man als offensichtlicher Westler auch ab und zu (in Peking und Shanghai häufig) angesprochen: „Can I talk with you? I want to practice my English.“ Kürzlich war es gar ein etwa zehnjähriger Junge, der so auf mich zu kam. Und kecke Primarschülerinnen rufen mir „Hello teacher“ zu, wenn ich über den Schulhof gehe, Oberstufenschüler auch mal „Guten Tag“.

Die Klassenzimmer werden von den Klassen mit Sujets aus Deutschland geschmückt, hier haben sie sogar die Ventilatoren in den deutschen Farben gestrichen.
Im Unterricht aber herrschen, wie gesagt, eher Schüchternheit und Hemmung vor. Dazu kommt der strukturelle Einfluss der wichtigen Abschlussprüfungen, die nur schriftlich sind. Die Gao Kao, die grosse Prüfung, die am Ende des 12. Schuljahres über die weitere Bildungslaufbahn entscheidet, fordert in der Fremdsprache Grammatik, Textverständnis und einen kleinen Aufsatz von 150 Wörtern. Das heisst: Schriftliche Übungen sind besser für die Prüfungen, also werden sie bevorzugt, so hat bezeichnenderweise die 12. Klasse keine Konversationsstunde mehr, sie muss sich auf das „Wichtige“ konzentrieren. Diese Fixierung des Sprachenlernens auf das Schriftliche gilt nicht nur für China, in Japan ist sie womöglich noch stärker. Aber man versucht jetzt immerhin etwas Gegensteuer zu geben. Die Deutschschülerinnen und -schüler in meiner Schule werden im Lauf des Unterrichts auch auf die Prüfungen des Goethe-Instituts gemäss europäischem Sprachenportfolio (A1 bis B1) vorbereitet und an diese Prüfungen geschickt, welche ihnen im Fall eines Auslandstudiums nützlich sein werden.

Mit so kleinen Gruppen wie dieser 10. Anfänger-Klasse kommt man natürlich rascher voran als mit den 25 Anfängern der 7. Klasse (oder den 40-50, die in Englischklassen sitzen) – ein Schüler hat nach ein paar Wochen zu Japanisch gewechselt, weil ihm Deutsch zu schwierig vorkam.
Sprachunterricht schliesst in China Literatur nicht ein. Selbst im Unistudium fristet diese ein Randdasein: In einer Vorlesungsstunde pro Woche erfahren Deutschstudentinnen zwar, dass es ein Nibelungenlied gibt, den Inhalt kennen sie hingegen nicht; und die Texte der Schriftsteller und Dichter gelten meist als zu schwierig. An der Mittelschule gilt das erst recht. Zwar kann es sein, dass man mit Heines „Lorelei“ die Aussprache übt, ansonsten aber sind es nur Sachtexte, die in den Lehrbüchern vorkommen. Über Land und Leute (Deutschland, Österreich und Schweiz) und die Gesellschaft erfährt man da allerdings einiges. Bei guten Schülern sind die Kenntnisse der deutschsprachigen Länder oft erstaunlich. Zwei Schülerinnen der Abschlussklasse, die seit fünf Jahren Deutschunterricht haben, rufen, als ich meine Herkunft Basel nenne, wie aus der Pistole geschossen: „Das liegt in der Dreiländerecke.“
Fremdsprachenunterricht ist, wie gesagt, das langsame Bohren dicker Bretter. Als ich nach einer zähen Lektion, wo ich gar keine Fortschritte zu erkennen meine, die Lehrerin der Klasse frage, was man ihrer Ansicht nach besser machen könne, sagt sie lachend: „Nichts - Übung macht den Meister“. Alte deutsche Tugenden passen in die chinesische Schule. Meine eigenen langsamen Fortschrittlein im Chinesischen - seine Zeichen, seine Töne und die vielen gleichklingenden Bedeutungen können einen verzweifeln lassen – stimmen mich nachsichtig gegenüber meinen Schülern.
Deutsch lernen an der Mittelschule also. Meine Schule, die Xian Foreign Language School, hat Fremdsprachen als Schwerpunkt. Englisch beginnt schon in der Primarschule, in der Sekundarstufe I (7. - 9. Klasse) kommt eine zweite Fremdsprache dazu: Japanisch, Spanisch, Französisch oder Deutsch (3 oder 4 Lektionen pro Woche). Ab der 10. Klasse konzentrieren sich die Schüler wieder auf eine Fremdsprache: Englisch oder eine der genannten, die man auch dann noch neu anfangen kann (in dem Fall intensiv mit 10 Lektionen pro Woche). Diese Fremdsprache wird an der grossen nationalen Abschlussprüfung am Ende der 12. Klasse als eines von fünf Fächern geprüft.Es ist natürlich eine Minderheit, die Deutsch lernt, ebenso wie Französisch und Spanisch; am beliebtesten ist Englisch, es gilt auch als leichter - wie Japanisch, von dem man viele Zeichen schon kennt.
Fremdsprachenunterricht ist langsames, oft mühsames Bohren dicker Bretter, auch und gerade ich China, dessen Sprache in vielem so anders ist. Chinesische Schüler kämpfen vor allem mit der Aussprache von Lauten, die es in ihrer Sprache nicht gibt – manche versteht man noch nach Jahren Deutschunterricht schlecht – und natürlich mit der Grammatik: Deutsch zu lernen, wenn man in der eigenen Sprache weder Artikel noch Pluralformen, weder Deklination noch Konjugation kennt, ist harte Arbeit. Umso verwunderlicher ist es, wie schnell einzelne Schülerinnen und Schüler vorankommen – es gibt aber auch die, welche nach Jahren noch keinen geraden Satz aufs Papier, geschweige denn über die Lippen kriegen.

Moderner Unterricht: Partnerarbeit – die Lehrerin am Rand
Methodisch ist der Fremdsprachenunterricht durchaus auf der Höhe der Zeit. In Deutsch braucht man Bücher, die in Deutschland konzipiert wurden und arbeitet mit dem Goethe-Institut zusammen; die Methodik sieht zahlreiche verschiedene Aktivitäten für Hören, Lesen, Verstehen, Schreiben vor, auch Partner- und Gruppenarbeiten gibt es. Daneben sind auch ältere chinesische Methoden wie das Wiederholen im Chor und das Auswendiglernen verbreitet – in grossen Klassen die einzige Möglichkeit, damit alle üben; vor allem Englischklassen hört man häufig im Chor dem Tonband oder der Lehrerin nachsprechen. Der Nachteil dieser Methode: Schwächere Schülerinnen und Schüler können so unerkannt mitschwimmen, die Kluft zwischen Guten und Schwachen wird schnell sehr gross. Auch typisch chinesisch scheint mir, dass das Buch zentral ist: es wird vor- und rückwärts gelernt und repetiert. Was nicht im Buch vorkommt, ist im Moment interessant, wird aber nur von den Besten vielleicht memoriert.
Die Schule ist bestrebt, möglichst in jeder Sprache einen Muttersprachler für Konversationsstunden, aber auch als Auskunftsperson für die chinesischen Sprachlehrpersonen zu beschäftigen. So gibt es neben mir einen älteren Japaner, der für ein Jahr hierher gekommen ist und sich täglich selbst japanisches Essen zubereitet, weil er das Chinesische nicht vertrage (zu viel Fleisch!). Andere leben schon länger in China, sind aber neu an der Schule: ein junger Franzose, der gerade eine Chinesin geheiratet hat , ausgebildeter Ökonom, der parallel eine Dissertation schreibt; ein junger Spanier, der mit seiner Freundin hier lebt, und ein Südafrikaner, ebenfalls verheiratet mit einer Chinesin – er hält das chinesische Erziehungswesen für zu stark aufs Auswendiglernen und zu wenig aufs Denken ausgerichtet; wenn seine Kinder, die jetzt in der Primarschule sind, ins Mittelstufenalter kämen, werde er in ein anderes Land ziehen. Die Schwierigkeit mit der Konversation im Unterricht ist neben der sprachlichen Barriere eine gewisse Schüchternheit– die Hemmungen zu reden sind bei vielen gross – nicht nur im Unterricht.
Ein junger Mann spricht mich in der Warteschlange im Supermarkt an. Ob ich Amerikaner sei. Sein Englisch ist gut verständlich. Wir kommen ins Gespräch. Es stellt sich heraus, dass er in Xian Betriebswirtschaft studiert und vor kurzem das Studium abgeschlossen hat, seit kurzem arbeitet er. Wir sind auf der Strasse angelangt, er bedankt sich, er sei emotional sehr bewegt. Zum ersten Mal habe er einen Ausländer angesprochen – er habe sich das schon so oft gewünscht, aber nie getraut, weil er sein Englisch für zu schlecht halte – und dass daraus ein Gespräch geworden sei, mache ihn sehr glücklich.Auf der andern Seite wird man als offensichtlicher Westler auch ab und zu (in Peking und Shanghai häufig) angesprochen: „Can I talk with you? I want to practice my English.“ Kürzlich war es gar ein etwa zehnjähriger Junge, der so auf mich zu kam. Und kecke Primarschülerinnen rufen mir „Hello teacher“ zu, wenn ich über den Schulhof gehe, Oberstufenschüler auch mal „Guten Tag“.

Die Klassenzimmer werden von den Klassen mit Sujets aus Deutschland geschmückt, hier haben sie sogar die Ventilatoren in den deutschen Farben gestrichen.
Im Unterricht aber herrschen, wie gesagt, eher Schüchternheit und Hemmung vor. Dazu kommt der strukturelle Einfluss der wichtigen Abschlussprüfungen, die nur schriftlich sind. Die Gao Kao, die grosse Prüfung, die am Ende des 12. Schuljahres über die weitere Bildungslaufbahn entscheidet, fordert in der Fremdsprache Grammatik, Textverständnis und einen kleinen Aufsatz von 150 Wörtern. Das heisst: Schriftliche Übungen sind besser für die Prüfungen, also werden sie bevorzugt, so hat bezeichnenderweise die 12. Klasse keine Konversationsstunde mehr, sie muss sich auf das „Wichtige“ konzentrieren. Diese Fixierung des Sprachenlernens auf das Schriftliche gilt nicht nur für China, in Japan ist sie womöglich noch stärker. Aber man versucht jetzt immerhin etwas Gegensteuer zu geben. Die Deutschschülerinnen und -schüler in meiner Schule werden im Lauf des Unterrichts auch auf die Prüfungen des Goethe-Instituts gemäss europäischem Sprachenportfolio (A1 bis B1) vorbereitet und an diese Prüfungen geschickt, welche ihnen im Fall eines Auslandstudiums nützlich sein werden.

Mit so kleinen Gruppen wie dieser 10. Anfänger-Klasse kommt man natürlich rascher voran als mit den 25 Anfängern der 7. Klasse (oder den 40-50, die in Englischklassen sitzen) – ein Schüler hat nach ein paar Wochen zu Japanisch gewechselt, weil ihm Deutsch zu schwierig vorkam.
Sprachunterricht schliesst in China Literatur nicht ein. Selbst im Unistudium fristet diese ein Randdasein: In einer Vorlesungsstunde pro Woche erfahren Deutschstudentinnen zwar, dass es ein Nibelungenlied gibt, den Inhalt kennen sie hingegen nicht; und die Texte der Schriftsteller und Dichter gelten meist als zu schwierig. An der Mittelschule gilt das erst recht. Zwar kann es sein, dass man mit Heines „Lorelei“ die Aussprache übt, ansonsten aber sind es nur Sachtexte, die in den Lehrbüchern vorkommen. Über Land und Leute (Deutschland, Österreich und Schweiz) und die Gesellschaft erfährt man da allerdings einiges. Bei guten Schülern sind die Kenntnisse der deutschsprachigen Länder oft erstaunlich. Zwei Schülerinnen der Abschlussklasse, die seit fünf Jahren Deutschunterricht haben, rufen, als ich meine Herkunft Basel nenne, wie aus der Pistole geschossen: „Das liegt in der Dreiländerecke.“
Fremdsprachenunterricht ist, wie gesagt, das langsame Bohren dicker Bretter. Als ich nach einer zähen Lektion, wo ich gar keine Fortschritte zu erkennen meine, die Lehrerin der Klasse frage, was man ihrer Ansicht nach besser machen könne, sagt sie lachend: „Nichts - Übung macht den Meister“. Alte deutsche Tugenden passen in die chinesische Schule. Meine eigenen langsamen Fortschrittlein im Chinesischen - seine Zeichen, seine Töne und die vielen gleichklingenden Bedeutungen können einen verzweifeln lassen – stimmen mich nachsichtig gegenüber meinen Schülern.
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 27. Oktober 2014
Reisen in China: Bahn, Schiff, Bus etc.
wernerbaumann, 15:34h
Nach ein paar Erfahrungen lässt sich folgende Zwischenbilanz ziehen: Am bequemsten ist es natürlich mit einer westlichen Reisegruppe; in Gruppen mit Chinesen wird man überbehütet, allein geht es manchmal besser, manchmal ist es auch schwieriger. Die neuen Transportmittel U-Bahnen und Superschnellzüge sind sehrzweckmässig, bequem und effizient; die älteren – traditionelle Bahn und Busse – verlangen weit mehr Geduld. Die Chinesen sind, anders als man das oft liest, sehr hilfsbereit, manchmal aber fremdsprachlich schon sehr limitiert. Und dass es so viele Chinesen gibt – zu viele, sagt „Jimmy“ – macht es auch nicht immer einfacher.
Jimmy, so nennt sich der Mann vom Reisebüro in Qongching, der sich wie alle Chinesen für den Kontakt mit Westlern einen westlichen Namen zugelegt hat. Er holt uns zwei am Flughafen ab und soll uns aufs Schiff bringen für eine dreitägige Reise durch die be-rühmten der Schluchten des Yangtse. Er spricht nicht nur ausgezeichnet Englisch und war schon in der Schweiz (auch auf dem Jungfraujoch), er hat auch viel Zeit und zeigt uns stolz das Zentrum vom Chongqing, der formell – wenn man den dazugehörenden Landkreis dazu rechnet – grössten Stadt der Welt. Eine Boomtown mit beeindruckend moderner City auf einem Hügel zwischen zwei Flüssen, wimmelnd vom Menschen; zwi-schen gläsernen Wolkenkratzern verborgen findet man einen Tempel.


Zweimal Chongqing. Das Opernhaus leuchtet in der Nacht und hat eine Bildschirmfassade
Jimmy bezeichnet das eine Extrem von Chinesen, mit denen man es zu tun haben kann beim Reisen; das andere sind die drei Damen an der Rezeption des Hotels in Wuhan, auch einer Millionenstadt, drei Tage später: keine kann auch nur ein Wort englisch, und auch meine chinesischen Brocken wollen sie erst im dritten Anlauf verstehen.
Auf der Schiffsreise sind die Chinesen die grosse Mehrheit, zwei westliche Reisegruppen werden von chinesischen Reiseleitern eng betreut. Wir trotten mit, wenn es Ausflüge gibt, am runden Zehnertisch beim Essen werden wir von den Chinesen „betreut“, die interessiert unsere Handhabung der Stäbchen verfolgen und dafür schauen, dass wir genug erhalten. Ein Lautsprecher, in jeder Kabine vorhanden und wie üblich zu laut eingestellt, weckt am morgen und gibt den ganzen Tag durch, was zu tun, wann zu essen, was zu sehen ist – zum Glück lässt sich der Stecker ausziehen, der akustische Terror wäre sonst kaum auszuhalten.

In den Schluchten
Seit der Drei-Schluchten-Staudamm steht, ist der Wasserspiegel des Yangtse gestiegen und der Fluss breiter geworden, die Schluchten sind aber immer noch beeindruckend. Das Schiff fährt durch, hält da und dort, einmal gibt es einen Ausflug in einen Nebenfluss, wo eine ethnische Minderheit wohnt. In einem neu gebauten Kulturzentrum kann man einen 2000 Jahre alten Sarg bewundern, wie sie in der Gegend in Felsspalten deponiert wurden; und in Fantasy-Kostümen werden angeblich traditionelle Tänze präsentiert. Am Ufer tauchen ab und zu neue weisse Städte auf, welche für die in den Fluten versunkenen Dörfer gebaut wurden. Sie sehen nicht schlecht aus, es soll da aber, erzählt eine lokale Führerin, teilweise dreizehnstöckige Hochhäuser ohne Lift geben – ob absichtlich oder aus Unachtsamkeit, ist unklar.

Neue Stadt
Der Drei-Schluchten-Staudamm wurde errichtet, um das grösste Wasserkraftwerk der Welt zu betreiben. Erste Pläne dafür gehen auf den Republikgründer Sun Yatsen Anfang 20. Jh. Zurück. Beschlossen wurde der Bau 1992, fertiggestellt 2006, 2008 wurde das Kraftwerk in Betrieb gesetzt. Das Vorhaben war in China und ausserhalb umstritten. Die Befürworter argumentierten mit wirtschaftlicher Notwendigkeit und der Regulierung des riesigen Flusses, der immer wieder Überschwemmungen verursacht hatte, die Gegner führten ökonomische und ökologische Risiken ins Feld und kritisierten die Umsiedlungen. Seit der sehr breite, optisch aber wenig spektakuläre Bau in Betrieb ist, hört man wenig darüber, wie er sich bewährt – das Internet (auf deutsch und englisch) bietet wenig Informationen darüber, wie sich Nachteile und Nutzen nun entwickeln. Hatte der SPIEGEL 2010 noch berichtet, dass wegen Hochwasser Müllmassen den Damm zu verstopfen drohten, so berichtete ein Jahr später die „Welt“, der niedrige Wasserstand sei ein Problem für das Kraftwerk und die weiter meerwärts liegenden Gebiete, und die Regierung habe Nachbesserungen angekündigt. Neuere Auseinandersetzungen mit dem Thema gibt es offenbar nicht - was mehr über den Medienbetrieb aussagt als über als über den Damm.
Die Behörden haben daraus eine Touristenattraktion gemacht, Tausende werden in Bussen herangeführt, schauen von der Plattform herunter und werden an Modellen über die Funktionsweise orientiert.

Seilbahn auf den Huashan
Einen eintägigen Ausflug zum Huashan, einem im Daoismus heiligen Berg 120 km östlich von Xian, haben wir beim lokalen Reisebüro gebucht. Am Morgen zwischen 7 und 8 Uhr sammelt der Bus eine Stunde lang die Teilnehmer in der ganzen Stadt ein – es sind ausser uns nur Chinesen. Die Reiseleiterin orientiert im Bus die Teilnehmer in einem dreiviertelstündigen, staccatohaft ohne Punkt und Komma vorgetragenen Referat; da sie schlecht englisch kann, kommen wir mit einer zweiminütigen Zusammenfassung davon. Um elf wird die Fahrt unterbrochen, damit man in einer grossen Verpflegungsstätte essen kann. Es ist neblig und regnet leicht. So sind wir nicht so unglücklich, dass es extrem lang dauert, bis wir schliesslich mit der Gondelbahn auf dem Berg ankommen. Bei jeder Etappe wird die Gruppe wieder ausführlich instruiert, für uns reichen ein paar Brocken. Die Rückfahrt am Abend dauert endlos, das Verhältnis von Fahrzeit und Aufenthalt ist suboptimal.
Deshalb versuche ich es allein zwei Wochen später bei schönsten Herbstwetter noch-mals auf eigene Faust. Die Hinfahrt – U-Bahn zum neuen Schnellzugbahnhof, dann der 300 km/h-Schnellzug – ist optimal; 3 Stunden, nachdem ich das Haus verlassen habe, stehe ich auf dem Berg, der diesmal im Sonnenschein erstrahlt. Die Heimfahrt ist dann komplizierter und dauert nicht weniger lang als das letzte Mal: Da es keine Plätze in einem Schnellzug gibt, muss ich zuerst mit dem Taxi den Bahnhof wechseln, dort anderthalb Stunden auf den nächsten Zug warten, der natürlich nicht eine halbe, sondern zwei Stunden für die Strecke braucht und überfüllt ist. Dafür gibt es viel Volksleben zu sehen, im einfachen, etwas vergammelten Restaurant vor dem Bahnhof, wo an offenem Feuer eine wunderbare Nudelsuppe für umgerechnet einen Franken zubereitet wird, und im Gedränge im Zug, wo die Vielfalt der chinesischen Bevölkerung wieder einmal so augenscheinlich wird. Schon ein Wagen voller Leute zeigt, dass die Chinesen keine ethnisch, sondern eine kulturell definierte Nation sind – allein die Hautfarben decken die Bandbreite von Skandinavien bis Nordafrika ab. Es sind die immer schwarzen, lockenlosen Haare, die zu einem einheitlicheren Gesamtbild als in Europa führen, wobei die Mode, die Haare zu meist rötlich zu tönen und mit Dauerwellen zu verändern, hier bereits stark verbreitet ist bei Frauen und bei jungen Männern.

Huashan im Nebelregen
Der Huashan, ein 2000 m hoher Berg, der ziemlich unvermittelt aus der Ebene des Ge-lben Flusses aufsteigt, hat fünf Gipfel und gilt als schwierig im Aufstieg, muss man doch teilweise über Holzplanken entlang senkrechter Wände gehen. Doch es gibt nun zwei Seilbahnen, welche das Ganze zum spektakulären Kindespiel machen. Die häufig steilen Wege zwischen den fünf Gipfeln bestehen fast ausschliesslich aus Treppen, in den Fels gehauen oder aus Beton gebaut und mit Ketten gesichert. So kann man stundenlang treppauf und –ab steigen und fndet immer wieder wunderbare Aussichtspunkte, Tempel und Verpflegungsmöglichkeiten – der heilige Berg ist zum grossen Naturpark geworden. An einigen Stellen können die Mutigen eine senkrechte Wand hochsteigen oder sich auf einen Plankenweg hinunterhangeln für ein Foto. Die Treppenwege werden ständig gewischt, Parkwächter sammeln jede weggeworfene Petflasche sofort ein.

Huashan bei Sonnenschein
Beim ersten Besuch, wo der Nebel nur selten einen kleinen Ausblick gestattet, hat der Berg eine geheimnisvolle Aura. Der schöne Herbsttag hingegen, obwohl ein gewöhnli-cher Freitag, hat viele Leute angezogen. Es ist ein reges Kommen und Gehen, es wird geschrieen und gejauchzt, um das Echo zu testen.

Gut besuchter Berg
Dann ist es plötzlich wieder still und man hört nur eine melancholische Klarinettenmelodie eines älteren Mannes, der sich ins Gras gesetzt hat. Ein Soziologe hat Gesellschaften wie die chinesische „time compressingsocieties“ genannt: die Vergangenheit spielt eine grosse Rolle und ist sehr präsent, gleichzeitig ist die Veränderung so rasant, dass die Gegenwart eigentlich immer schon überholt ist und die Zukunft bereits in den Blick gerät. Bei der Rückfahrt im Zug sitzt vis-à-vis ein älterer Mann vom Land;die Haut von der Arbeit draussen gegerbt, sieht er aus wie aus einem alten China-Film - da klingelt sein Handy mit einer Melodie aus dem Forellenquintett von Schubert.

Jimmy, so nennt sich der Mann vom Reisebüro in Qongching, der sich wie alle Chinesen für den Kontakt mit Westlern einen westlichen Namen zugelegt hat. Er holt uns zwei am Flughafen ab und soll uns aufs Schiff bringen für eine dreitägige Reise durch die be-rühmten der Schluchten des Yangtse. Er spricht nicht nur ausgezeichnet Englisch und war schon in der Schweiz (auch auf dem Jungfraujoch), er hat auch viel Zeit und zeigt uns stolz das Zentrum vom Chongqing, der formell – wenn man den dazugehörenden Landkreis dazu rechnet – grössten Stadt der Welt. Eine Boomtown mit beeindruckend moderner City auf einem Hügel zwischen zwei Flüssen, wimmelnd vom Menschen; zwi-schen gläsernen Wolkenkratzern verborgen findet man einen Tempel.


Zweimal Chongqing. Das Opernhaus leuchtet in der Nacht und hat eine Bildschirmfassade
Jimmy bezeichnet das eine Extrem von Chinesen, mit denen man es zu tun haben kann beim Reisen; das andere sind die drei Damen an der Rezeption des Hotels in Wuhan, auch einer Millionenstadt, drei Tage später: keine kann auch nur ein Wort englisch, und auch meine chinesischen Brocken wollen sie erst im dritten Anlauf verstehen.
Auf der Schiffsreise sind die Chinesen die grosse Mehrheit, zwei westliche Reisegruppen werden von chinesischen Reiseleitern eng betreut. Wir trotten mit, wenn es Ausflüge gibt, am runden Zehnertisch beim Essen werden wir von den Chinesen „betreut“, die interessiert unsere Handhabung der Stäbchen verfolgen und dafür schauen, dass wir genug erhalten. Ein Lautsprecher, in jeder Kabine vorhanden und wie üblich zu laut eingestellt, weckt am morgen und gibt den ganzen Tag durch, was zu tun, wann zu essen, was zu sehen ist – zum Glück lässt sich der Stecker ausziehen, der akustische Terror wäre sonst kaum auszuhalten.

In den Schluchten
Seit der Drei-Schluchten-Staudamm steht, ist der Wasserspiegel des Yangtse gestiegen und der Fluss breiter geworden, die Schluchten sind aber immer noch beeindruckend. Das Schiff fährt durch, hält da und dort, einmal gibt es einen Ausflug in einen Nebenfluss, wo eine ethnische Minderheit wohnt. In einem neu gebauten Kulturzentrum kann man einen 2000 Jahre alten Sarg bewundern, wie sie in der Gegend in Felsspalten deponiert wurden; und in Fantasy-Kostümen werden angeblich traditionelle Tänze präsentiert. Am Ufer tauchen ab und zu neue weisse Städte auf, welche für die in den Fluten versunkenen Dörfer gebaut wurden. Sie sehen nicht schlecht aus, es soll da aber, erzählt eine lokale Führerin, teilweise dreizehnstöckige Hochhäuser ohne Lift geben – ob absichtlich oder aus Unachtsamkeit, ist unklar.

Neue Stadt
Der Drei-Schluchten-Staudamm wurde errichtet, um das grösste Wasserkraftwerk der Welt zu betreiben. Erste Pläne dafür gehen auf den Republikgründer Sun Yatsen Anfang 20. Jh. Zurück. Beschlossen wurde der Bau 1992, fertiggestellt 2006, 2008 wurde das Kraftwerk in Betrieb gesetzt. Das Vorhaben war in China und ausserhalb umstritten. Die Befürworter argumentierten mit wirtschaftlicher Notwendigkeit und der Regulierung des riesigen Flusses, der immer wieder Überschwemmungen verursacht hatte, die Gegner führten ökonomische und ökologische Risiken ins Feld und kritisierten die Umsiedlungen. Seit der sehr breite, optisch aber wenig spektakuläre Bau in Betrieb ist, hört man wenig darüber, wie er sich bewährt – das Internet (auf deutsch und englisch) bietet wenig Informationen darüber, wie sich Nachteile und Nutzen nun entwickeln. Hatte der SPIEGEL 2010 noch berichtet, dass wegen Hochwasser Müllmassen den Damm zu verstopfen drohten, so berichtete ein Jahr später die „Welt“, der niedrige Wasserstand sei ein Problem für das Kraftwerk und die weiter meerwärts liegenden Gebiete, und die Regierung habe Nachbesserungen angekündigt. Neuere Auseinandersetzungen mit dem Thema gibt es offenbar nicht - was mehr über den Medienbetrieb aussagt als über als über den Damm.
Die Behörden haben daraus eine Touristenattraktion gemacht, Tausende werden in Bussen herangeführt, schauen von der Plattform herunter und werden an Modellen über die Funktionsweise orientiert.

Seilbahn auf den Huashan
Einen eintägigen Ausflug zum Huashan, einem im Daoismus heiligen Berg 120 km östlich von Xian, haben wir beim lokalen Reisebüro gebucht. Am Morgen zwischen 7 und 8 Uhr sammelt der Bus eine Stunde lang die Teilnehmer in der ganzen Stadt ein – es sind ausser uns nur Chinesen. Die Reiseleiterin orientiert im Bus die Teilnehmer in einem dreiviertelstündigen, staccatohaft ohne Punkt und Komma vorgetragenen Referat; da sie schlecht englisch kann, kommen wir mit einer zweiminütigen Zusammenfassung davon. Um elf wird die Fahrt unterbrochen, damit man in einer grossen Verpflegungsstätte essen kann. Es ist neblig und regnet leicht. So sind wir nicht so unglücklich, dass es extrem lang dauert, bis wir schliesslich mit der Gondelbahn auf dem Berg ankommen. Bei jeder Etappe wird die Gruppe wieder ausführlich instruiert, für uns reichen ein paar Brocken. Die Rückfahrt am Abend dauert endlos, das Verhältnis von Fahrzeit und Aufenthalt ist suboptimal.
Deshalb versuche ich es allein zwei Wochen später bei schönsten Herbstwetter noch-mals auf eigene Faust. Die Hinfahrt – U-Bahn zum neuen Schnellzugbahnhof, dann der 300 km/h-Schnellzug – ist optimal; 3 Stunden, nachdem ich das Haus verlassen habe, stehe ich auf dem Berg, der diesmal im Sonnenschein erstrahlt. Die Heimfahrt ist dann komplizierter und dauert nicht weniger lang als das letzte Mal: Da es keine Plätze in einem Schnellzug gibt, muss ich zuerst mit dem Taxi den Bahnhof wechseln, dort anderthalb Stunden auf den nächsten Zug warten, der natürlich nicht eine halbe, sondern zwei Stunden für die Strecke braucht und überfüllt ist. Dafür gibt es viel Volksleben zu sehen, im einfachen, etwas vergammelten Restaurant vor dem Bahnhof, wo an offenem Feuer eine wunderbare Nudelsuppe für umgerechnet einen Franken zubereitet wird, und im Gedränge im Zug, wo die Vielfalt der chinesischen Bevölkerung wieder einmal so augenscheinlich wird. Schon ein Wagen voller Leute zeigt, dass die Chinesen keine ethnisch, sondern eine kulturell definierte Nation sind – allein die Hautfarben decken die Bandbreite von Skandinavien bis Nordafrika ab. Es sind die immer schwarzen, lockenlosen Haare, die zu einem einheitlicheren Gesamtbild als in Europa führen, wobei die Mode, die Haare zu meist rötlich zu tönen und mit Dauerwellen zu verändern, hier bereits stark verbreitet ist bei Frauen und bei jungen Männern.

Huashan im Nebelregen
Der Huashan, ein 2000 m hoher Berg, der ziemlich unvermittelt aus der Ebene des Ge-lben Flusses aufsteigt, hat fünf Gipfel und gilt als schwierig im Aufstieg, muss man doch teilweise über Holzplanken entlang senkrechter Wände gehen. Doch es gibt nun zwei Seilbahnen, welche das Ganze zum spektakulären Kindespiel machen. Die häufig steilen Wege zwischen den fünf Gipfeln bestehen fast ausschliesslich aus Treppen, in den Fels gehauen oder aus Beton gebaut und mit Ketten gesichert. So kann man stundenlang treppauf und –ab steigen und fndet immer wieder wunderbare Aussichtspunkte, Tempel und Verpflegungsmöglichkeiten – der heilige Berg ist zum grossen Naturpark geworden. An einigen Stellen können die Mutigen eine senkrechte Wand hochsteigen oder sich auf einen Plankenweg hinunterhangeln für ein Foto. Die Treppenwege werden ständig gewischt, Parkwächter sammeln jede weggeworfene Petflasche sofort ein.

Huashan bei Sonnenschein
Beim ersten Besuch, wo der Nebel nur selten einen kleinen Ausblick gestattet, hat der Berg eine geheimnisvolle Aura. Der schöne Herbsttag hingegen, obwohl ein gewöhnli-cher Freitag, hat viele Leute angezogen. Es ist ein reges Kommen und Gehen, es wird geschrieen und gejauchzt, um das Echo zu testen.

Gut besuchter Berg
Dann ist es plötzlich wieder still und man hört nur eine melancholische Klarinettenmelodie eines älteren Mannes, der sich ins Gras gesetzt hat. Ein Soziologe hat Gesellschaften wie die chinesische „time compressingsocieties“ genannt: die Vergangenheit spielt eine grosse Rolle und ist sehr präsent, gleichzeitig ist die Veränderung so rasant, dass die Gegenwart eigentlich immer schon überholt ist und die Zukunft bereits in den Blick gerät. Bei der Rückfahrt im Zug sitzt vis-à-vis ein älterer Mann vom Land;die Haut von der Arbeit draussen gegerbt, sieht er aus wie aus einem alten China-Film - da klingelt sein Handy mit einer Melodie aus dem Forellenquintett von Schubert.

... link (1 Kommentar) ... comment
Donnerstag, 16. Oktober 2014
Leben in Xian: Mehr Lebensqualität dank historischem Erbe
wernerbaumann, 07:06h
Xian ist eine grosse, dicht bebaute und wegen der Winde aus der Lössebene meist etwas staubige Stadt. Die zahlreichen Alleen mildern diesen Eindruck, und in den letzten Jahren hat die Stadt die Pflege ihres kulturellen Erbes genutzt, um die Lebensqualität der Einwohnerzu verbessern. Nicht nur für die Touristen wird denreichen historischen Überresten grosse Aufmerksamkeit gewidmet. Neben dem „Tang Paradise“, einem grossen Themenpark im Süden der Stadt um zwei Seen mit mehr Kitsch als Geschichte ist in den letzten Jahren der riesige Park um den Daming-Palast entstanden und der Park um die Stadtmauer ist erneuert worden.

Im Damingpark
Das ausgedehnte Daming-Palast-Areal, erbaut nach Plänen, die unter der einzigen chinesischen Kaiserin im 7. Jahrhundert entworfen wurden, diente den Tang-Kaisern während mehr als zwei Jahrhunderten als Residenz – hier war das Zentrum des damals grössten Reichs der Welt in der grössten Stadt der Welt. Die über 3 km2 grosse Residenzstadt – viermal die Fläche der Verbotenen Stadt in Peking - wurde zum Vorbild für spätere Palastareale. 1957 wurden Überreste im Norden der Altstadt Xians entdeckt. Nachdem die archäologischen Arbeiten 1995-2003 realisiert werden konnten, wurde aus dem Gebiet ein Park gemacht. Ganze Quartiere und Fabriken wurden niedergerissen, Schulen verlegt und das Areal freigemacht – der Park nähert sich damit den Dimensionen des New Yorker Central Parks. Fototafeln zeigen den Zustand von 2008: enge Quartiere (ehemalige Dörfer), Einkaufszentren, wo heute Wiesen und Bäume sind. Die Teiche und Kanäle wurden wieder hergestellt, von den Gebäuden aber nur die wenigsten, oft wurden auch nur in moderner Bauweise die Konturen nachgezeichnet; am häufigsten sind die Grundrisse markiert, indem das Areal mit Ziegelsteinen um 50 Zentimeter erhöht wurde. Infotafeln auf Chinesisch und Englisch, Modelle von Palästen, Bronzefiguren u. ä. informieren über das ehemals Gewesene, es gibt auch ein archäologisches Zentrum. Zur Hauptsache ist der 2010 eröffnete Park aber eine riesige Grünfläche, die meist noch recht spärlich bevölkert ist; man kann ungestört Velo fahren, Drachen steigen lassen, Picknicken usw.

Eines der wenigen rekonstruierten Gebäude im Daming-Park
Man sieht dem Park teilweise an, dass er noch jung ist, viele Bäume sind noch klein, es gibt aber auch alte Baumbestände. Wenn man genug hat vom Lärm und der schlechten Luft der Stadt, bieteter eine willkommene Abwechslung. Was für ein Kontrast zu den engen Quartieren und den Brachflächen, die es im gleichen Stadtteil auch gibt; da wurden offenbar Gevierte niedergerissen, ohne dass man gleich baut: übersät von Müllhaufen, in den Menschen Recyclingfähiges sammeln, am Rand Ruinen und in einigen noch stehenden alten Häusern das übliche Leben mit Garküchen, Reparaturwerkstätten und Coiffeuren.

Auch das gibt es im selben Quartier
Auch rund um die Stadtmauer gibt es Erholungsfläche. Die renovierte 14.5 km lange ununterbrochene Stadtmauer ist als solches schon eine Attraktion – man kann sie mit dem Velo befahren oder begehen, aber das kostet etwas und ist eher für die Touristen.

Auf der Mauer
Gratis kann man sich hingegen im ebenso langen Park bewegen, der sich auf der Aussenseite entlang zieht und nur bei den heute zwölf Toren von teilweise schwer zu überwindenden Strassen unterbrochen wird. Der Park zwischen der Mauer und dem ausserhalb liegenden, ebenfalls rechteckig angelegten Kanal ist zwischen 20 und 50 m breit und vielfältig mit Bäumen und Büschen bepflanzt. Er ist voller Kinderspielplätze, Pingpongtische und Fitnessgeräte, die vor allem von älteren Menschen genutzt werden. Er ist in den letzten Jahren erneuert worden und wird sorgfältig gepflegt. Die ständig sichtbare hohe Stadtmauer gibt ihm eine besondere Atmosphäre; das gilt im übrigen auch für die Strassen an der Innenseite der Stadtmauer. So dient das enorme Bauwerk, das seinerzeit Feinde abhalten sollte, heute ganz anderen Bedürfnissen.


Park entlang der Mauer

Im Damingpark
Das ausgedehnte Daming-Palast-Areal, erbaut nach Plänen, die unter der einzigen chinesischen Kaiserin im 7. Jahrhundert entworfen wurden, diente den Tang-Kaisern während mehr als zwei Jahrhunderten als Residenz – hier war das Zentrum des damals grössten Reichs der Welt in der grössten Stadt der Welt. Die über 3 km2 grosse Residenzstadt – viermal die Fläche der Verbotenen Stadt in Peking - wurde zum Vorbild für spätere Palastareale. 1957 wurden Überreste im Norden der Altstadt Xians entdeckt. Nachdem die archäologischen Arbeiten 1995-2003 realisiert werden konnten, wurde aus dem Gebiet ein Park gemacht. Ganze Quartiere und Fabriken wurden niedergerissen, Schulen verlegt und das Areal freigemacht – der Park nähert sich damit den Dimensionen des New Yorker Central Parks. Fototafeln zeigen den Zustand von 2008: enge Quartiere (ehemalige Dörfer), Einkaufszentren, wo heute Wiesen und Bäume sind. Die Teiche und Kanäle wurden wieder hergestellt, von den Gebäuden aber nur die wenigsten, oft wurden auch nur in moderner Bauweise die Konturen nachgezeichnet; am häufigsten sind die Grundrisse markiert, indem das Areal mit Ziegelsteinen um 50 Zentimeter erhöht wurde. Infotafeln auf Chinesisch und Englisch, Modelle von Palästen, Bronzefiguren u. ä. informieren über das ehemals Gewesene, es gibt auch ein archäologisches Zentrum. Zur Hauptsache ist der 2010 eröffnete Park aber eine riesige Grünfläche, die meist noch recht spärlich bevölkert ist; man kann ungestört Velo fahren, Drachen steigen lassen, Picknicken usw.

Eines der wenigen rekonstruierten Gebäude im Daming-Park
Man sieht dem Park teilweise an, dass er noch jung ist, viele Bäume sind noch klein, es gibt aber auch alte Baumbestände. Wenn man genug hat vom Lärm und der schlechten Luft der Stadt, bieteter eine willkommene Abwechslung. Was für ein Kontrast zu den engen Quartieren und den Brachflächen, die es im gleichen Stadtteil auch gibt; da wurden offenbar Gevierte niedergerissen, ohne dass man gleich baut: übersät von Müllhaufen, in den Menschen Recyclingfähiges sammeln, am Rand Ruinen und in einigen noch stehenden alten Häusern das übliche Leben mit Garküchen, Reparaturwerkstätten und Coiffeuren.

Auch das gibt es im selben Quartier
Auch rund um die Stadtmauer gibt es Erholungsfläche. Die renovierte 14.5 km lange ununterbrochene Stadtmauer ist als solches schon eine Attraktion – man kann sie mit dem Velo befahren oder begehen, aber das kostet etwas und ist eher für die Touristen.

Auf der Mauer
Gratis kann man sich hingegen im ebenso langen Park bewegen, der sich auf der Aussenseite entlang zieht und nur bei den heute zwölf Toren von teilweise schwer zu überwindenden Strassen unterbrochen wird. Der Park zwischen der Mauer und dem ausserhalb liegenden, ebenfalls rechteckig angelegten Kanal ist zwischen 20 und 50 m breit und vielfältig mit Bäumen und Büschen bepflanzt. Er ist voller Kinderspielplätze, Pingpongtische und Fitnessgeräte, die vor allem von älteren Menschen genutzt werden. Er ist in den letzten Jahren erneuert worden und wird sorgfältig gepflegt. Die ständig sichtbare hohe Stadtmauer gibt ihm eine besondere Atmosphäre; das gilt im übrigen auch für die Strassen an der Innenseite der Stadtmauer. So dient das enorme Bauwerk, das seinerzeit Feinde abhalten sollte, heute ganz anderen Bedürfnissen.


Park entlang der Mauer
... link (0 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 2. Oktober 2014
Hartes Schülerleben
wernerbaumann, 13:54h
Ob die Chinesen wirklich härter arbeiten als wir im alten Europa, wie oft suggeriert wird, ist generell schwer zu beantworten. Wie bei uns gibt es grosse Unterschiede. Wenn man hier lebt, gewinnt man den Eindruck, dass zwar einerseits viele Leute geschäftig sind - z. B. im Auftrag Trottoirs wischen oder auf eigene Rechnung wiederverwertbaren Abfall sammeln, was zu sehr sauberen Strassen und Trottoirs führt trotz enormem Publikumsverkehr. Anderseits gibt es überall, in den Geschäften und in andern Einrichtungen, viele unterbeschäftigt herumsitzende Leute, Aufsichts- und Wachpersonal,wie es für Entwicklungsländer typisch ist, und als solches bezeichnet auch die chinesische Regierung ihr Land immer noch. Was man natürlich nicht sieht, sind die, welche in Fabriken und auf den riesigen Baustellen arbeiten. Ein älterer Amerika-Chinese, in Kalifornien aufgewachsen, der seit zehn Jahren in Xian lebt und arbeitet und täglich zwei Stunden im Fitnesszentrum verbringt, hält das Leben hier jedenfalls für viel entspannter als in den USA, darum lebe er gern hier.
Was aber zweifelsfrei feststeht: Schüler haben ein hartes Leben in China. In „meiner“ Schule beginnt um 7.25 ein 25-minütiger Frühunterricht, wo in täglich wechselnden Fächern kleine Übungen, Diktate o. ä. gemacht werden. Dann versammelt sich, wenn es nicht regnet, die ganze Schule auf den Sportplätzen zum etwa eine Viertelstunde dauernden Frühsport – eine Mischung aus militärischen Marsch- und Turnübungen und Tai-Chi-Bewegungen (im Winterhalbjahr wird diese Sequenz zwischen die 3. und 4. Lektiom nach 10 Uhr verlegt). Etwa 1'500 Primarschüler bewegen sich zu Marsch- und Popmusik auf dem grossen Sportplatz nach dem Kommando eines Sportlehrers, die Mittelschule teilt sich auf zwei kleinere Sportplätze auf.

Frühsport
Ab 8 Uhr 15 folgen fünf 40-minütige Lektionen, unterbrochen von 10-minütigen Pausen. Von 12.15 bis 14.20 ist Mittagspause. Man kann in der Mensa essen oder nach Hause gehen, wenn man in der Nähe wohnt. Viele gehen auch ins Quartier, um sich zu verköstigen. Dann folgen vier Nachmittagslektionen, anschliessend nochmals eine halbe Stunde Abendunterricht, wo wie am Morgen kleinere Einheiten geübt werden. Nach dem Abendessen gibt es von 19.10 bis 20 und von 20.10 bis 21 Uhr nochmals zwei Stunden für diejenigen, die in der Schule wohnen – hier werden Aufgaben erledigt und wird nachgeübt; wer zuhause wohnt, kann das dort erledigen. Dieser Tagesplan bedeutet natürlich auch eine starke Belastung für die Lehrpersonen, die während des Unterrichts in der Schule sein müssen, wo sie einen Arbeitsplatz zur Vorbereitung und Korrektur haben und wo Schülerinnen und Schüler sie auch für Fragen aufsuchen.
Das Ganze an fünf Tagen die Woche (nur am Freitag ist um fünf Schluss). Und auch übers Wochenende gibt es noch Hausaufgaben. Und wenn - wie jetzt wegen des Nationalfeiertags, wo eine Woche frei ist - ein paar Tage ausserhalb der Ferien ausfallen, dann werden sie teilweise am Sonntag vorher und am Samstag danach vor- und nachgeholt! Ausserdem müssen die 9. und 12. Klassen, welche am Jahresende Prüfungen haben, oft am Sonntag für Zusatzunterricht zur Schule kommen, ganztags! Kein Wunder, dass viele Schüler über eine zu hohe Belastung klagen. Auch Primarschüler sieht man nach acht Uhr abends noch im Schulzimmer mit Aufgaben oder Nachhilfeunterricht. Ein Junge, der seit zehn Jahren Klavier spielt, sagt, er komme nur noch am Wochenende zum Üben. Und doch ist das keine Eliteschule, die hauptsächlich auf die Prüfungen trimmt. In der „besten“ Schule von Xian, d. h. der, die bei den grossen nationalen Abschlussprüfungen Gaokao am besten abschneidet und als halbprivate Schule auch viel besser ausgestattet ist, hat man den Eindruck, es werde noch viel mehr gefordert – jedenfalls hat die Schule es für nötig befunden, einen Erholungs- und Kompensationsbereich einzurichten, wo es neben Spielen auch lebensgrosseDummypuppen gibt, auf die man einschlagen kann.
Die guten Leistungen werden auch an „meiner“ Schule gelobt, aber nicht so stark in den Vordergrund gestellt. Am Freitag Nachmittag der dritten Schulwoche versammelte sich die ganze Mittelschule auf dem Sportplatz vor der Schule. Ein Transparent vorne über der Tribüne, wo die Schulleitung sass, enthielt die Ziele der Schule, u. a. Internationalität.
Schüler und Lehrpersonen sasseneinigermassen in Reih und Glied auf den aus dem Schulhaus mitgebrachten Hockern. Etwa 20 LP und 150 SuS standen während der ganzen Zeremonie von mehr als einer Stunde am Rand – die Lehrpersonen wurden ausgezeichnet für besondere Beiträge zum Unterricht, die Schülerinnen und Schüler für die besten Leistungen sowie – bemerkenswert - auch die grössten Fortschritte während des letzten Schuljahres.

Auszeichnungen zum Schuljahresbeginn
Der Druck auf die Schüler manifestiert sich nicht in autoritärem Unterrichtsstil, die Lehrpersonen – da es eine Schule mit Schwerpunkt Sprachen ist, in der Mehrzahl Frauen – gehen eher sanft mit ihnen um. Der Druck auf Schüler und Lehrpersonen geht letztlich von den Abschlussprüfungen aus. Am Ende der Junior High School (7.-9. Klasse) entscheidet eine Prüfung an der Schule, wer in die 10. Klasse aufgenommen wird. Etwa die Hälfte besteht, die andern müssen sich eine andere (weniger gute) Schule suchen - Berufslehren gibt es nicht. Der grosse Endpunkt der Schulkarriere aber schwebt über allem: am Ende der 12. Klasse entscheidet die grosse nationale Prüfung (Gao kao), die provinzweise abgeändert werden kann, wer in eine Universitätaufgenommen wird, und wenn ja, in eine wie renommierte. Auch hier besteht etwa die Hälfte der bis zehn Millionen, die jährlich daran teilnehmen – die andern können es entweder nochmals versuchen oder eine Arbeit suchen.
Es scheint, dass ein solches System auf die Schule zurückstrahlt und dort möglichst viel Unterrichtszeit und möglichst viel Auswendiglernen fördert. Das legt jedenfalls der Vergleich mit dem sonst ganz anderen Land Chile nahe, das eine ähnliche nationale Schlussprüfung kennt und wo auch 44 Lektionen Unterricht pro Woche vorgeschrieben sind. Der Unterschied: In Chile wurde das System unter der Pinochet-Diktatur als neoliberales Anreiz-Modell eingeführt (die Resultate der Schulen werden, anders als in hier in China, in der Zeitung veröffentlicht), in China hingegen haben nationale Prüfungen und die Reproduktion von angelerntem Wissen eine zweitausendjährige Tradition; sie dienten im Kaiserreich der Rekrutierung von Beamten und Gelehrten und führten in den Blütezeiten einiger Dynastien wirklich dazu, dass China verglichen mit andern Weltgegenden besser regiert wurde. Umso schwieriger dürfte es werden, das heutige System einmal umzukrempeln, auch wenn es erste Stimmen gibt, die das möchten.
Was aber zweifelsfrei feststeht: Schüler haben ein hartes Leben in China. In „meiner“ Schule beginnt um 7.25 ein 25-minütiger Frühunterricht, wo in täglich wechselnden Fächern kleine Übungen, Diktate o. ä. gemacht werden. Dann versammelt sich, wenn es nicht regnet, die ganze Schule auf den Sportplätzen zum etwa eine Viertelstunde dauernden Frühsport – eine Mischung aus militärischen Marsch- und Turnübungen und Tai-Chi-Bewegungen (im Winterhalbjahr wird diese Sequenz zwischen die 3. und 4. Lektiom nach 10 Uhr verlegt). Etwa 1'500 Primarschüler bewegen sich zu Marsch- und Popmusik auf dem grossen Sportplatz nach dem Kommando eines Sportlehrers, die Mittelschule teilt sich auf zwei kleinere Sportplätze auf.

Frühsport
Ab 8 Uhr 15 folgen fünf 40-minütige Lektionen, unterbrochen von 10-minütigen Pausen. Von 12.15 bis 14.20 ist Mittagspause. Man kann in der Mensa essen oder nach Hause gehen, wenn man in der Nähe wohnt. Viele gehen auch ins Quartier, um sich zu verköstigen. Dann folgen vier Nachmittagslektionen, anschliessend nochmals eine halbe Stunde Abendunterricht, wo wie am Morgen kleinere Einheiten geübt werden. Nach dem Abendessen gibt es von 19.10 bis 20 und von 20.10 bis 21 Uhr nochmals zwei Stunden für diejenigen, die in der Schule wohnen – hier werden Aufgaben erledigt und wird nachgeübt; wer zuhause wohnt, kann das dort erledigen. Dieser Tagesplan bedeutet natürlich auch eine starke Belastung für die Lehrpersonen, die während des Unterrichts in der Schule sein müssen, wo sie einen Arbeitsplatz zur Vorbereitung und Korrektur haben und wo Schülerinnen und Schüler sie auch für Fragen aufsuchen.
Das Ganze an fünf Tagen die Woche (nur am Freitag ist um fünf Schluss). Und auch übers Wochenende gibt es noch Hausaufgaben. Und wenn - wie jetzt wegen des Nationalfeiertags, wo eine Woche frei ist - ein paar Tage ausserhalb der Ferien ausfallen, dann werden sie teilweise am Sonntag vorher und am Samstag danach vor- und nachgeholt! Ausserdem müssen die 9. und 12. Klassen, welche am Jahresende Prüfungen haben, oft am Sonntag für Zusatzunterricht zur Schule kommen, ganztags! Kein Wunder, dass viele Schüler über eine zu hohe Belastung klagen. Auch Primarschüler sieht man nach acht Uhr abends noch im Schulzimmer mit Aufgaben oder Nachhilfeunterricht. Ein Junge, der seit zehn Jahren Klavier spielt, sagt, er komme nur noch am Wochenende zum Üben. Und doch ist das keine Eliteschule, die hauptsächlich auf die Prüfungen trimmt. In der „besten“ Schule von Xian, d. h. der, die bei den grossen nationalen Abschlussprüfungen Gaokao am besten abschneidet und als halbprivate Schule auch viel besser ausgestattet ist, hat man den Eindruck, es werde noch viel mehr gefordert – jedenfalls hat die Schule es für nötig befunden, einen Erholungs- und Kompensationsbereich einzurichten, wo es neben Spielen auch lebensgrosseDummypuppen gibt, auf die man einschlagen kann.
Die guten Leistungen werden auch an „meiner“ Schule gelobt, aber nicht so stark in den Vordergrund gestellt. Am Freitag Nachmittag der dritten Schulwoche versammelte sich die ganze Mittelschule auf dem Sportplatz vor der Schule. Ein Transparent vorne über der Tribüne, wo die Schulleitung sass, enthielt die Ziele der Schule, u. a. Internationalität.
Schüler und Lehrpersonen sasseneinigermassen in Reih und Glied auf den aus dem Schulhaus mitgebrachten Hockern. Etwa 20 LP und 150 SuS standen während der ganzen Zeremonie von mehr als einer Stunde am Rand – die Lehrpersonen wurden ausgezeichnet für besondere Beiträge zum Unterricht, die Schülerinnen und Schüler für die besten Leistungen sowie – bemerkenswert - auch die grössten Fortschritte während des letzten Schuljahres.

Auszeichnungen zum Schuljahresbeginn
Der Druck auf die Schüler manifestiert sich nicht in autoritärem Unterrichtsstil, die Lehrpersonen – da es eine Schule mit Schwerpunkt Sprachen ist, in der Mehrzahl Frauen – gehen eher sanft mit ihnen um. Der Druck auf Schüler und Lehrpersonen geht letztlich von den Abschlussprüfungen aus. Am Ende der Junior High School (7.-9. Klasse) entscheidet eine Prüfung an der Schule, wer in die 10. Klasse aufgenommen wird. Etwa die Hälfte besteht, die andern müssen sich eine andere (weniger gute) Schule suchen - Berufslehren gibt es nicht. Der grosse Endpunkt der Schulkarriere aber schwebt über allem: am Ende der 12. Klasse entscheidet die grosse nationale Prüfung (Gao kao), die provinzweise abgeändert werden kann, wer in eine Universitätaufgenommen wird, und wenn ja, in eine wie renommierte. Auch hier besteht etwa die Hälfte der bis zehn Millionen, die jährlich daran teilnehmen – die andern können es entweder nochmals versuchen oder eine Arbeit suchen.
Es scheint, dass ein solches System auf die Schule zurückstrahlt und dort möglichst viel Unterrichtszeit und möglichst viel Auswendiglernen fördert. Das legt jedenfalls der Vergleich mit dem sonst ganz anderen Land Chile nahe, das eine ähnliche nationale Schlussprüfung kennt und wo auch 44 Lektionen Unterricht pro Woche vorgeschrieben sind. Der Unterschied: In Chile wurde das System unter der Pinochet-Diktatur als neoliberales Anreiz-Modell eingeführt (die Resultate der Schulen werden, anders als in hier in China, in der Zeitung veröffentlicht), in China hingegen haben nationale Prüfungen und die Reproduktion von angelerntem Wissen eine zweitausendjährige Tradition; sie dienten im Kaiserreich der Rekrutierung von Beamten und Gelehrten und führten in den Blütezeiten einiger Dynastien wirklich dazu, dass China verglichen mit andern Weltgegenden besser regiert wurde. Umso schwieriger dürfte es werden, das heutige System einmal umzukrempeln, auch wenn es erste Stimmen gibt, die das möchten.
... link (1 Kommentar) ... comment
Montag, 22. September 2014
Leben in Xian: Velofahren und anderes
wernerbaumann, 12:12h
Im Museum
Museen in China sind, wenn man eine Identitätskarte zeigt, meist gratis, Spezialausstellungen, auch manche historischen Stätten wie die zu Museen umfunktionierten Wohnhäuser von bedeutenden Chinesinnen und Chinesen wie Lu Xun (Schriftsteller), Sun Yat-Sen (erster Staatspräsident der Republik 1912), Mao, Chou En-Lai, Song Qiling (Frau von Sun Yat-Sen und wichtige Figur im kommunistischen China) sind nur teilweise gratis, teilweise kosten sie etwas.
Besuch im historischen Museum der Provinz Shaanxi in Xian. Sonntag, viele Leute, alle Altersklassen. Eindrückliche Objekte von 5-6000 v. Chr. bis zur Qing-Dynastie (besonders schöne Tang-Keramik) illustrieren das beeindruckende Alter der chinesischen Kultur, das im heutigen China wieder stark betont wird. Das Museum wurde 1991 eröffnet als „Erziehungsbasis des Patriotismus“ und war das erste „Demonstrationsmodell für die moralische Erziehung der Heranwachsenden“ in der Provinz, so eine Tafel am Eingang. Ein Student hat mir am Tag zuvor als freiwilliger Propagandist im Stadtzentrum empfohlen dahin zu gehen. Zwar würden viele Einheimische es besuchen (10 Millionen hätten es bis jetzt besucht, heisst es auf der erwähnten Tafel), aber die Fremden noch nicht. Er ist heute vor dem Museum, sieht mich und ist sehr erfreut, dass ich seiner Empfehlung gefolgt bin.
Teambuilding

Nachmittags halb sechs auf dem breiten Trottoir einer Hauptstrasse stehen etwas achtzehn Angestellte eines Restaurants in zwei Reihen, militärisch exakt, hinten die Köche, mit einer Ausnahme Männer, vorne die Serviceangestellten, alles Frauen, alle in Arbeitskleidung. Vorne stehen die Chefin des Service und der Chef des Ganzen, der einzige mit Krawatte. Zuerst redet die Chefin, alle klatschen, dann redet der Chef; er schliesst mit Parolen, die mit kollektiven Rufen beantwortet werden, dazwischen wird gelacht, alle klatschen wieder. Nun wirft der Chef einen Stoffball in die Runde und während der folgenden Viertelstunde wird auf dem Trottoir mit viel Gelächter und Gekreisch „Völkerball“ gespielt, immer Service und Chef gegen Köche, dazwischen wird gewechselt. Kurz vor sechs pfeift der Chef, alle sammeln sich wieder, nochmals kurze Ansprache, nochmals ein paar Parolen und Antwortrufe, Strammstehen, dann geht es in Zweierkolonne ins Restaurant im 1. Stock des Gebäudes dahinter. Eine Stunde später wollte ich dort essen gehen – es war überfüllt, am Eingang standen die Leute Schlange.
Ähnliche Appelle“ sieht man auch anderswo ständig, allerdings ohne Ballspiel. Manche machen Tanzbewegungen oder andere Bewegungsübungen, besprechen sich im Kreis wie eine Fussballmannschaft vor dem Match oder müssen sich in Zweierkolonne einfach die Ansprache des Chefs/der Chefin anhören.

Velofahren
Zwar ist China nicht mehr das Land der Fahrräder wie vor zwanzig Jahren. Auch hier scheint es ein ehernes Gesetz, dass wirtschaftliches Wachstum sich im Auto ausdrückt. Und so stehen jetzt halt auch die Chinesen im Stau und suchen sich einen Parkplatz, wo es keinen gibt, und halten das für Fortschritt. Immerhin haben die Behörden reagiert und bauen in rasantem Tempo einerseits ein Hochgeschwindigkeits U-Bahnen. Peking hat in wenigen Jahren das längste U-Bahnnetz der Welt in den Boden gegraben und baut weiter, in Xian gibt es seit etwa drei Jahren zwei Linien in Form eines Kreuzes, drei weitere sind im Bau.
Und immerhin hat Xian wie viele andere chinesische Städte nach dem Vorbild mancher europäischer Städte ein praktisches Veloverleihsystem errichtet. Mit gut 40 Fr. Depot erwirbt man sich das Recht, mit seiner ÖV-Karte (U-Bahn und Bus) ein Velo zu nehmen an einer der Stationen, die sich alle paar hundert Meter finden, und es an einer beliebigen anderen Station wieder zu deponieren. Die erste Stunde ist gratis, die zweite kostet 15 Rp., und auch nachher ist es nicht viel teurer. Es sind eher behäbige, einfache Räder, aber so, wie der Verkehr hier läuft, kann man ohnehin nicht schnell fahren, und Gänge sind hier, wo es topfeben ist, auch nicht nötig - immerhin kann man den Sattel verstellen und es hat ein Kabelschloss dran. Das System wird gut genutzt, ein beträchtlicher Anteil der Velofahrer, die man sieht, sind mit solchen Rädern unterwegs, daneben gibt es viele alte Klappergestelle, seltener Mountainbikes, noch seltener elegante Fixies.
Velofahren ist auch hier ein Vergnügen, allerdings ein beschränktes, und das nicht nur, weil man oft nur langsam vorankommt. Das liegt zum einen an der Verkehrsdichte. Auf den grossen Strassen ist man auf separaten Spuren eigentlich bequem unterwegs, aber da fahren auch die zahlreichen lautlos dahinflitzenden Elektorscooter - solche mit Benzinmotoren sind nicht mehr erlaubt, und auch die klapprigsten alten Modelle sind auf elektrischen Antrieb umgerüstet; dasselbe gilt für die dreirädrigen Rikschas, die zur Personenbeförderung, zum Warentransport und von fliegenden Händlern benutzt werden. Auch einzelne Autos nutzen die Spur bei Stau mal als Ausweichmöglichkeit, so wie Scooter und Velos im selben Fall auf Trottoirs ausweichen. In kleineren Strassen, wo die Radstreifen nur aufgemalt sind, gibt es zahlreiche stehende Hindernisse, vor allem Autos, die hier ungeniert parkiert werden, oder sie sind an dichten Stellen von Fussgängern überflutet.
Zum andern wird das Vergnügen dadurch beeinträchtigt, dass die Verkehrsregeln durch das Recht des Stärkeren überlagert werden (allerdings nehmen auch die Schwachen sich ihr Recht, wo sie können). Autos kommen zuerst, auch auf Fussgängerstreifen bei Grün haben die Fussgänger auszuweichen oder stehenzubleiben, wenn ein Autofahrer abbiegen will. Aber auch die Elektroscooter, die zwar vor den Autos kuschen müssen, nehmen sich viele Rechte, wenn sie lautlos und nachts ohne Licht herumflitzen. Die Velofahrer halten sich an fast gar nichts, fahren auch auf dem Trottoir, haben aber nur eine sanfte Klingel, keine Hupe wie die Scooter und Rikschas, die sich damit den Weg bahnen. Die Fussgänger schliesslich rebellieren, indem sie überall sich durchzuschlängeln versuchen, auch bei Rot über eine sechs- oder achtspurige Strasse. Darauf wiederum reagieren die Autofahrer weniger mit Bremsen als mit Hupen. Als Velofahrer dem ständigen Gehupe ausgesetzt zu sein, ist an sich nicht schlimm, schwierig wird es an grossen Kreuzungen, die man ja auch als Velofahrer irgendwie überqueren muss und wo man mit all den genannten Phänomenen gleichzeitig konfrontiert wird – da helfen einem Velostreifen wenig.
Museen in China sind, wenn man eine Identitätskarte zeigt, meist gratis, Spezialausstellungen, auch manche historischen Stätten wie die zu Museen umfunktionierten Wohnhäuser von bedeutenden Chinesinnen und Chinesen wie Lu Xun (Schriftsteller), Sun Yat-Sen (erster Staatspräsident der Republik 1912), Mao, Chou En-Lai, Song Qiling (Frau von Sun Yat-Sen und wichtige Figur im kommunistischen China) sind nur teilweise gratis, teilweise kosten sie etwas.
Besuch im historischen Museum der Provinz Shaanxi in Xian. Sonntag, viele Leute, alle Altersklassen. Eindrückliche Objekte von 5-6000 v. Chr. bis zur Qing-Dynastie (besonders schöne Tang-Keramik) illustrieren das beeindruckende Alter der chinesischen Kultur, das im heutigen China wieder stark betont wird. Das Museum wurde 1991 eröffnet als „Erziehungsbasis des Patriotismus“ und war das erste „Demonstrationsmodell für die moralische Erziehung der Heranwachsenden“ in der Provinz, so eine Tafel am Eingang. Ein Student hat mir am Tag zuvor als freiwilliger Propagandist im Stadtzentrum empfohlen dahin zu gehen. Zwar würden viele Einheimische es besuchen (10 Millionen hätten es bis jetzt besucht, heisst es auf der erwähnten Tafel), aber die Fremden noch nicht. Er ist heute vor dem Museum, sieht mich und ist sehr erfreut, dass ich seiner Empfehlung gefolgt bin.
Teambuilding

Nachmittags halb sechs auf dem breiten Trottoir einer Hauptstrasse stehen etwas achtzehn Angestellte eines Restaurants in zwei Reihen, militärisch exakt, hinten die Köche, mit einer Ausnahme Männer, vorne die Serviceangestellten, alles Frauen, alle in Arbeitskleidung. Vorne stehen die Chefin des Service und der Chef des Ganzen, der einzige mit Krawatte. Zuerst redet die Chefin, alle klatschen, dann redet der Chef; er schliesst mit Parolen, die mit kollektiven Rufen beantwortet werden, dazwischen wird gelacht, alle klatschen wieder. Nun wirft der Chef einen Stoffball in die Runde und während der folgenden Viertelstunde wird auf dem Trottoir mit viel Gelächter und Gekreisch „Völkerball“ gespielt, immer Service und Chef gegen Köche, dazwischen wird gewechselt. Kurz vor sechs pfeift der Chef, alle sammeln sich wieder, nochmals kurze Ansprache, nochmals ein paar Parolen und Antwortrufe, Strammstehen, dann geht es in Zweierkolonne ins Restaurant im 1. Stock des Gebäudes dahinter. Eine Stunde später wollte ich dort essen gehen – es war überfüllt, am Eingang standen die Leute Schlange.
Ähnliche Appelle“ sieht man auch anderswo ständig, allerdings ohne Ballspiel. Manche machen Tanzbewegungen oder andere Bewegungsübungen, besprechen sich im Kreis wie eine Fussballmannschaft vor dem Match oder müssen sich in Zweierkolonne einfach die Ansprache des Chefs/der Chefin anhören.

Velofahren
Zwar ist China nicht mehr das Land der Fahrräder wie vor zwanzig Jahren. Auch hier scheint es ein ehernes Gesetz, dass wirtschaftliches Wachstum sich im Auto ausdrückt. Und so stehen jetzt halt auch die Chinesen im Stau und suchen sich einen Parkplatz, wo es keinen gibt, und halten das für Fortschritt. Immerhin haben die Behörden reagiert und bauen in rasantem Tempo einerseits ein Hochgeschwindigkeits U-Bahnen. Peking hat in wenigen Jahren das längste U-Bahnnetz der Welt in den Boden gegraben und baut weiter, in Xian gibt es seit etwa drei Jahren zwei Linien in Form eines Kreuzes, drei weitere sind im Bau.
Und immerhin hat Xian wie viele andere chinesische Städte nach dem Vorbild mancher europäischer Städte ein praktisches Veloverleihsystem errichtet. Mit gut 40 Fr. Depot erwirbt man sich das Recht, mit seiner ÖV-Karte (U-Bahn und Bus) ein Velo zu nehmen an einer der Stationen, die sich alle paar hundert Meter finden, und es an einer beliebigen anderen Station wieder zu deponieren. Die erste Stunde ist gratis, die zweite kostet 15 Rp., und auch nachher ist es nicht viel teurer. Es sind eher behäbige, einfache Räder, aber so, wie der Verkehr hier läuft, kann man ohnehin nicht schnell fahren, und Gänge sind hier, wo es topfeben ist, auch nicht nötig - immerhin kann man den Sattel verstellen und es hat ein Kabelschloss dran. Das System wird gut genutzt, ein beträchtlicher Anteil der Velofahrer, die man sieht, sind mit solchen Rädern unterwegs, daneben gibt es viele alte Klappergestelle, seltener Mountainbikes, noch seltener elegante Fixies.
Velofahren ist auch hier ein Vergnügen, allerdings ein beschränktes, und das nicht nur, weil man oft nur langsam vorankommt. Das liegt zum einen an der Verkehrsdichte. Auf den grossen Strassen ist man auf separaten Spuren eigentlich bequem unterwegs, aber da fahren auch die zahlreichen lautlos dahinflitzenden Elektorscooter - solche mit Benzinmotoren sind nicht mehr erlaubt, und auch die klapprigsten alten Modelle sind auf elektrischen Antrieb umgerüstet; dasselbe gilt für die dreirädrigen Rikschas, die zur Personenbeförderung, zum Warentransport und von fliegenden Händlern benutzt werden. Auch einzelne Autos nutzen die Spur bei Stau mal als Ausweichmöglichkeit, so wie Scooter und Velos im selben Fall auf Trottoirs ausweichen. In kleineren Strassen, wo die Radstreifen nur aufgemalt sind, gibt es zahlreiche stehende Hindernisse, vor allem Autos, die hier ungeniert parkiert werden, oder sie sind an dichten Stellen von Fussgängern überflutet.
Zum andern wird das Vergnügen dadurch beeinträchtigt, dass die Verkehrsregeln durch das Recht des Stärkeren überlagert werden (allerdings nehmen auch die Schwachen sich ihr Recht, wo sie können). Autos kommen zuerst, auch auf Fussgängerstreifen bei Grün haben die Fussgänger auszuweichen oder stehenzubleiben, wenn ein Autofahrer abbiegen will. Aber auch die Elektroscooter, die zwar vor den Autos kuschen müssen, nehmen sich viele Rechte, wenn sie lautlos und nachts ohne Licht herumflitzen. Die Velofahrer halten sich an fast gar nichts, fahren auch auf dem Trottoir, haben aber nur eine sanfte Klingel, keine Hupe wie die Scooter und Rikschas, die sich damit den Weg bahnen. Die Fussgänger schliesslich rebellieren, indem sie überall sich durchzuschlängeln versuchen, auch bei Rot über eine sechs- oder achtspurige Strasse. Darauf wiederum reagieren die Autofahrer weniger mit Bremsen als mit Hupen. Als Velofahrer dem ständigen Gehupe ausgesetzt zu sein, ist an sich nicht schlimm, schwierig wird es an grossen Kreuzungen, die man ja auch als Velofahrer irgendwie überqueren muss und wo man mit all den genannten Phänomenen gleichzeitig konfrontiert wird – da helfen einem Velostreifen wenig.
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 17. September 2014
Was einen erwartet
wernerbaumann, 12:18h

Lotusblumen in den kaiserlichen Gärten von Beijing
Ich arbeite ein halbes Jahr als Deutschlehrer an einer Mittelschule in Xian und veröffentliche in diesem Blog von Zeit zu Zeit Texte und Bilder. Nicht von Tag-zu-Tag-Befindlichkeiten, nicht Angaben über Morgenessen und Abendweh oder Meinungen und Weisheiten, wie das in vielen Blogs der Fall ist, sondern Erlebnisse, Beobachtungen und Versuche, diese einzuordnen.
Heute 24.1.2015 habe ich meinen letzten Beitrag veröffentlicht, nächste Woche reise ich nach Hause nach Basel. W. B.
... link
Maos Mausoleum
wernerbaumann, 11:59h
An einem Regentag morgens um halb acht habe ich mir weniger Andrang erhofft. Bereits sind Tausende auf dem riesigen Platz, und die meisten wollen wie ich das Mao-Mausoleum sehen.
Der Tienanmen, der Platz des Himmlischen Friedens, benannt nach dem Südtor zur Verbotenen Stadt, an dessen Front Maos Portrait hängt, ist seit bald hundert Jahren das politische Zentrum Chinas – seit Studenten hier 1919 demonstrierten und damit die Bewegung des 4. Mai lostraten, die erste moderne Massenbewegung Chinas. Der Anlass: China, das seit 1840 von den imperialistischen Mächten Mal für Mal gedemütigt worden war, hatte sich von den Nachkriegsverhandlungen in Versailles eine Besserstellung erhofft. Als klar wurde, dass das nicht der Fall war, kam es zu den Protesten der Studenten: Sie protestierten gegen die Haltung der Regierung, die in den Verhandlungen in Versailles akzeptierte, dass China weiterhin in der Rolle einer Halbkolonie verblieb und gar Japans Expansionsgelüsten entgegenkam, und sie forderten eine Erneuerung der Kultur.
Dreissig Jahre später rief Mao nach dem Sieg der Kommunisten im Bürgerkrieg hier die Volksrepublik China aus und stellte damit die Souveränität und Einheit Chinas nach einem Jahrhundert der Demütigung und des Zerfalls wieder her. In der Folge liess er den Platz zur heutigen monumentalen Grösse erweitern für Massenaufmärsche und Paraden – er soll der grösste Platz der Welt sein. Hier versammelten sich Mitte der 1960er Jahre hunderttausende von fanatisierten Jugendlichen und jubelten, sein Rotes Büchlein schwenkend, ihrem Idol Mao zu und wünschten ihm in Sprechchören ein zehntausendjähriges Leben. Hier legten aber auch zehn Jahre später Tausende Blumen am Denkmal der Volkshelden nieder zum Gedenken an den Tod von Chou Enlai, des populären und pragmatischen Ministerpräsidenten während der ganzen Maozeit; sie leiteten damit den Sturz der maoistischen Viererbande und den Aufstieg von Deng Xiao Ping ein, dem grossen Reformer des modernen China. Und hier wiederum begann mit Blumen für den verstorbenen liberalen Parteichef Hu Yaobang Ende der 1980er Jahre die Studentenbewegung für mehr Freiheit und Demokratie, die in eine wochenlange Besetzung des Platzes mündete, welche nach einem Machtkampf in der Führung schliesslich im Juni 1989 mit Dengs Billigung mit dem weltweit für Empörung sorgenden Massaker der Armee beendet wurde ( Peter G. Achten hat dazu einen sehr informativen Artikel zum 25. Jahrestag geschrieben auf www.infosperber.ch/Artikel/FreiheitRecht/China-Tienanmen-Volksaufstand-25Jahrestag).
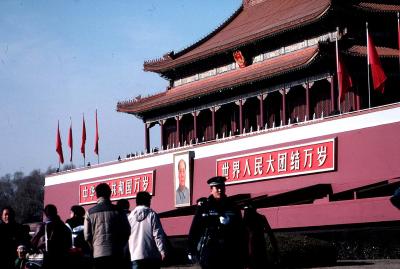
Tor de Himmlischen Friedens
Seither wurde der Zugang zum Platz zunehmend eingeschränkt und kontrolliert. Freiheit und nationale Selbstbehauptung, radikale Revolution und demokratische Reformen markieren seine Geschichte. Die Bewegung des 4. Mai wird heute noch hochgehalten, die Kulturrevolution gilt heute als Fehlentwicklung und als Fehler von Mao, die folgenden basisdemokratischen Bewegungen spielen keine grosse Rolle mehr in der von der Führung kontrollierten nationalen Erinnerung; das Tienanmen-Massaker wird gänzlich totgeschwiegen, viele Chinesen wissen 25 Jahre danach nichts davon. Die Ausrufung der Volksrepublik 1949 steht heute ganz im Zentrum des heutigen Platzes: Darum hängt heute noch Maos Porträt über dem Tor des Himmlischen Friedens und der Hauptteil des Platzes wird eingenommen vom Mausoleum, in welchem Mao Ze Dong einbalsamiert ruht, und den Menschenschlangen, die täglich Schlange stehen, um an ihm vorbeizudefilieren und einen kurzen Blick auf seinen konservierten Leichnam zu werfen.
Wenn man den Sicherheitscheck passiert hat, den es seit den Anschlägen uigurischer Separatisten vor ein paar Jahren gibt, passiert hat und wenn man auf dem Platz ankommt, merkt man: Die Hälfte ist verstellt von umfangreichen Absperranlagen, die einen Weg definieren, welcher die Volksmassen ordnet und einen reibungslosen Ablauf garantieren soll. In zügigem Wandertempo geht es anfangs in einer Art Kontermarsch durch den schlangenförmig angelegten Parcours, hin und her, dann verlangsamt sich das Tempo, die Kolonne stockt, und wenn man meint, man sei jetzt dann bei der Treppe, merkt man, dass der Weg zuerst noch um das halbe Gebäude herum und wieder zurück geführt ist. Wärterinnen und Wärter, mit Megaphon und Schirm bewaffnet, überwachen das korrekte Vorgehen, die einen eher lockerégère, die andern grimmig, die dritten, gleichgültig – dass bei einem Vorfall schnell andere Sicherheitskräfte zur Stelle wären, ist spürbar. Die bunte Menge – ein Querschnitt durch das chinesische Volk, wenig Alte, viele Junge, zahlreiche Kinder – ist gelöst, ruhig, trotz des leichten Regens, manchmal wird etwas gedrängelt, keine Unmutsbekundungen, auch als die Kolonne eine Viertelstunde stillsteht. So mag sich die chinesische Führung ihr Volk erhoffen. Was erhoffen sich die Wartenden?
Am Ende dauert das Schlangestehen eineinhalb Stunden. Dann geht es plötzlich wieder schneller, ein zweiter Sicherheitscheck (der Eintritt ist gratis, wenn man eine gültige Identitätskarte vorweist, die wird aber nur flüchtig oder gar nicht kontrolliert), und schon ist man auf der Treppe. Von jetzt an wird man zu zügigem Voranschreiten aufgefordert. In der ersten Halle inmitten von künstlichem Grün, davor frische weisse Chrysanthemensträusse, die man vor dem Aufgang kaufen kann, Mao in Marmor, etwa in doppelter Lebensgrösse in Onkelpose sitzend, wie man ihn von zahlreichen Gemälden kennt. Dann der Hauptraum, wo im Glassarg, der wiederum von einer grösseren Glashülle geschützt ist, der konservierte Leichnam liegt. Da ruht er in himmlischem Frieden, pfirsichfarben geschminkt wie eine Figur aus der Pekingoper – ausserhalb der Öffnungzeiten wird der Sarg angeblich in einen Kühlraum hinuntergefahren. Die Menschen eilen vorbei. Die Gesichter verraten nicht viel, Befriedigung vielleicht - man ist nach der langen Warterei froh, dass man durch ist. Sie habe nichts empfunden, sagt eine junge Frau aus der Nachbarprovinz, ihre Eltern aber hätten geweint.

Mausoleum
Wie soll man dieses in westlichen Augen skurrile Phänomen erklären? Das Regime brauche Mao zur Legitimation, wird im Westen in der Regel argumentiert. Das ist wohl richtig, aber warum in dieser Form? Und wie wäre dann zu erklären, dass so viele Chinesen hier Schlange stehen? Und dass, als die politische Führung 2012 – so heisst es - die Aufhebung des Mausoleums diskutierte, eine Welle der Empörung sie dazu brachte, die Idee fallen zu lassen?
Der Tiananmen-Platz mitsamt dem Mao-Mausoleum verkörpert die aktuelle Situation von China immer noch, vielleicht mehr denn je: die eines Reiches, das in ähnlicher Form wie seit Jahrtausenden regiert wird, nur die Hülle ist sogenannt kommunistisch. Es waren ja die sowjetischen Kommunisten unter Stalin, die mit der Einbalsamierung Lenins und seiner Zurschaustellung auf dem Roten Platz als erste moderne Machthaber diese eigenartige Totenehrung im 20. Jahrhundert begründet haben. China als zweite kommunistische Macht folgte nach dem Tod Maos 1976 dem Beispiel. Gleichzeitig folgte es der chinesischen Tradition, den Herrschern und insbesondere den Gründern von Dynastien riesige Grabmäler zu errichten – verglichen mit der unterirdischen Terracotta-Armee des ersten chinesischen Kaisers Qin sShihuang nimmt sich Maos Mausoleum geradezu bescheiden aus, kommunistisch sozusagen.
Denn wie jener Herrscher China geeinigt und damit eine mehr als zweitausendjährige Tradition begründet hatte – er wurde dafür von Mao bewundert, auch wenn er wegen Bücherverbrennungen und grausamer Brutalität in der chinesischen Geschichtsschreibung nicht sehr gut wegkommt -, so hat Mao das Reich aus der Demütigung von Fremdherrschaft und Zerfall befreit , eine 38-jährige Zeit innerer Kämpfe beendet und eine Art neue Dynastie gegründet. Sicher hatte er auch die Idee, eine kommunistische Gesellschaft der Gleichen zu errichten, aber er war sich auch selbst immer der Tradition bewusst, in der er stand. Auf dem Weg nach Peking 1949, als der Sieg der Kommunisten absehbar war, las er nicht Lenin, sondern tausendjährige Schriften über die Herrschaft. Selbstherrlich und rücksichtslos wie ein Kaiser regierte er das Land.
Nachdem die abrupten Wendungen seiner Herrschaft von Deng Xiao Ping immer mehr einer zielstrebigen Entwicklung und Wiederaufrichtung der Grösse Chinas Platz gemacht hatten, wurde immer deutlicher, dass die KPCh eine Art neue Dynastie war. Die Macht wird zwar nicht vererbt, sondern in einem undurchsichtigen, aber mittlerweile rationalisierten Verfahren für jeweils zehn Jahre an ein Führungsduo aus Partei- und Staatschef sowie Ministerpräsident weitergegeben – 2012 fand bereits der dritte solche Wechsel ohne grosse Nebengeräusche statt. Wie im Kaiserreich von der gebildeten konfuzianischen Beamtenschaft wird das Reich faktisch von einer Elite regiert, die sich den Zugang zur Macht formell über die Parteizugehörigkeit, aber auch über intensive Bildung (die Partei führt eigene grosse Kaderbildungsstätten) verschafft – nur ist diese Bildung nicht mehr literarisch wie bei den Konfuzianern (und auch noch bei Mao), sondern mehr ökonomisch, politisch, technisch; ausgebildete Ingenieure überwiegen in der obersten Führung. Indem sie 2004 den seit 1911 verfallenen und umgenutzen Tempel der Alten Kaiser, in welchem seit Jahrhunderten über 200 ehemalige Kaiser und hohe Beamte verehrt wurden, wiedererrichten restaurieren und rekonstruieren liess, stellte die Führung sich selbst in diese Kontiunität der chinesischen Geschchte. Eine neue Dynastie, aber immer noch in kommunistischer Hülle, auch wenn ihre Politik mit Kommunismus wenig mehr zu tun hat.

Im Tempel der Alten Kaiser in Beijing
Das wird auch deutlich im monumentalen Nationalmuseum auf der östlichen Seite des Platzes. Im Untergeschoss gibt es eine grosse, eindrückliche Ausstellung über die vier- bis fünftausendjährige Geschichte Chinas bis zum Fall des Kaiserreichs, ausgewogen kommentiert, schön ausgestellt, modernes Design, moderne Technik, State oft the Art. Die Ausstellung im 1. Stock über die Erneuerung und die Wiederauferstehung Chinas hingegen ist muffig und verstaubt, in heroisierendem Stil dekoriert, mit schlechten Fotoreproduktionen und Historienmalerei im Stil des sog. Sozialistischen Realismus illustriert. Abgestandene marxistische Floskeln statt Darstellung, man geht über Linoleum statt über Marmor und fühlt sich um Jahrzehnte zurückversetzt. Während unten exquisite Vasen aus früheren Epochen ausgestellt werden, trifft man hier auf eine kitschige Porzellankutsche – ein Geschenk von Putin an den vorherigen Staatschef Hu Jintao. Die Fallhöhe zwischen alter und gegenwärtiger Kultur ist hier sehr gross. Die Ausstellung hätte eine Erneuerung dringend nötig.
Mao selbst indes ist, auch wenn seine tatsächliche oder vielleicht auch nur angebliche leibliche Hülle immer noch im Mausoleum gezeigt wird, längst der politischen Sphäre entrückt – sein Portrait ziert, Ironie des Schicksals, die chinesischen Geldscheine und baumelt in Medaillons als Talisman an den Rückspiegeln von Taxi- und Busfahrern, eine Art Buddha.

Der Tienanmen, der Platz des Himmlischen Friedens, benannt nach dem Südtor zur Verbotenen Stadt, an dessen Front Maos Portrait hängt, ist seit bald hundert Jahren das politische Zentrum Chinas – seit Studenten hier 1919 demonstrierten und damit die Bewegung des 4. Mai lostraten, die erste moderne Massenbewegung Chinas. Der Anlass: China, das seit 1840 von den imperialistischen Mächten Mal für Mal gedemütigt worden war, hatte sich von den Nachkriegsverhandlungen in Versailles eine Besserstellung erhofft. Als klar wurde, dass das nicht der Fall war, kam es zu den Protesten der Studenten: Sie protestierten gegen die Haltung der Regierung, die in den Verhandlungen in Versailles akzeptierte, dass China weiterhin in der Rolle einer Halbkolonie verblieb und gar Japans Expansionsgelüsten entgegenkam, und sie forderten eine Erneuerung der Kultur.
Dreissig Jahre später rief Mao nach dem Sieg der Kommunisten im Bürgerkrieg hier die Volksrepublik China aus und stellte damit die Souveränität und Einheit Chinas nach einem Jahrhundert der Demütigung und des Zerfalls wieder her. In der Folge liess er den Platz zur heutigen monumentalen Grösse erweitern für Massenaufmärsche und Paraden – er soll der grösste Platz der Welt sein. Hier versammelten sich Mitte der 1960er Jahre hunderttausende von fanatisierten Jugendlichen und jubelten, sein Rotes Büchlein schwenkend, ihrem Idol Mao zu und wünschten ihm in Sprechchören ein zehntausendjähriges Leben. Hier legten aber auch zehn Jahre später Tausende Blumen am Denkmal der Volkshelden nieder zum Gedenken an den Tod von Chou Enlai, des populären und pragmatischen Ministerpräsidenten während der ganzen Maozeit; sie leiteten damit den Sturz der maoistischen Viererbande und den Aufstieg von Deng Xiao Ping ein, dem grossen Reformer des modernen China. Und hier wiederum begann mit Blumen für den verstorbenen liberalen Parteichef Hu Yaobang Ende der 1980er Jahre die Studentenbewegung für mehr Freiheit und Demokratie, die in eine wochenlange Besetzung des Platzes mündete, welche nach einem Machtkampf in der Führung schliesslich im Juni 1989 mit Dengs Billigung mit dem weltweit für Empörung sorgenden Massaker der Armee beendet wurde ( Peter G. Achten hat dazu einen sehr informativen Artikel zum 25. Jahrestag geschrieben auf www.infosperber.ch/Artikel/FreiheitRecht/China-Tienanmen-Volksaufstand-25Jahrestag).
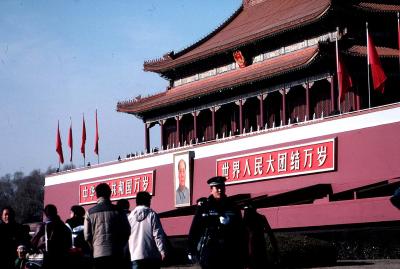
Tor de Himmlischen Friedens
Seither wurde der Zugang zum Platz zunehmend eingeschränkt und kontrolliert. Freiheit und nationale Selbstbehauptung, radikale Revolution und demokratische Reformen markieren seine Geschichte. Die Bewegung des 4. Mai wird heute noch hochgehalten, die Kulturrevolution gilt heute als Fehlentwicklung und als Fehler von Mao, die folgenden basisdemokratischen Bewegungen spielen keine grosse Rolle mehr in der von der Führung kontrollierten nationalen Erinnerung; das Tienanmen-Massaker wird gänzlich totgeschwiegen, viele Chinesen wissen 25 Jahre danach nichts davon. Die Ausrufung der Volksrepublik 1949 steht heute ganz im Zentrum des heutigen Platzes: Darum hängt heute noch Maos Porträt über dem Tor des Himmlischen Friedens und der Hauptteil des Platzes wird eingenommen vom Mausoleum, in welchem Mao Ze Dong einbalsamiert ruht, und den Menschenschlangen, die täglich Schlange stehen, um an ihm vorbeizudefilieren und einen kurzen Blick auf seinen konservierten Leichnam zu werfen.
Wenn man den Sicherheitscheck passiert hat, den es seit den Anschlägen uigurischer Separatisten vor ein paar Jahren gibt, passiert hat und wenn man auf dem Platz ankommt, merkt man: Die Hälfte ist verstellt von umfangreichen Absperranlagen, die einen Weg definieren, welcher die Volksmassen ordnet und einen reibungslosen Ablauf garantieren soll. In zügigem Wandertempo geht es anfangs in einer Art Kontermarsch durch den schlangenförmig angelegten Parcours, hin und her, dann verlangsamt sich das Tempo, die Kolonne stockt, und wenn man meint, man sei jetzt dann bei der Treppe, merkt man, dass der Weg zuerst noch um das halbe Gebäude herum und wieder zurück geführt ist. Wärterinnen und Wärter, mit Megaphon und Schirm bewaffnet, überwachen das korrekte Vorgehen, die einen eher lockerégère, die andern grimmig, die dritten, gleichgültig – dass bei einem Vorfall schnell andere Sicherheitskräfte zur Stelle wären, ist spürbar. Die bunte Menge – ein Querschnitt durch das chinesische Volk, wenig Alte, viele Junge, zahlreiche Kinder – ist gelöst, ruhig, trotz des leichten Regens, manchmal wird etwas gedrängelt, keine Unmutsbekundungen, auch als die Kolonne eine Viertelstunde stillsteht. So mag sich die chinesische Führung ihr Volk erhoffen. Was erhoffen sich die Wartenden?
Am Ende dauert das Schlangestehen eineinhalb Stunden. Dann geht es plötzlich wieder schneller, ein zweiter Sicherheitscheck (der Eintritt ist gratis, wenn man eine gültige Identitätskarte vorweist, die wird aber nur flüchtig oder gar nicht kontrolliert), und schon ist man auf der Treppe. Von jetzt an wird man zu zügigem Voranschreiten aufgefordert. In der ersten Halle inmitten von künstlichem Grün, davor frische weisse Chrysanthemensträusse, die man vor dem Aufgang kaufen kann, Mao in Marmor, etwa in doppelter Lebensgrösse in Onkelpose sitzend, wie man ihn von zahlreichen Gemälden kennt. Dann der Hauptraum, wo im Glassarg, der wiederum von einer grösseren Glashülle geschützt ist, der konservierte Leichnam liegt. Da ruht er in himmlischem Frieden, pfirsichfarben geschminkt wie eine Figur aus der Pekingoper – ausserhalb der Öffnungzeiten wird der Sarg angeblich in einen Kühlraum hinuntergefahren. Die Menschen eilen vorbei. Die Gesichter verraten nicht viel, Befriedigung vielleicht - man ist nach der langen Warterei froh, dass man durch ist. Sie habe nichts empfunden, sagt eine junge Frau aus der Nachbarprovinz, ihre Eltern aber hätten geweint.

Mausoleum
Wie soll man dieses in westlichen Augen skurrile Phänomen erklären? Das Regime brauche Mao zur Legitimation, wird im Westen in der Regel argumentiert. Das ist wohl richtig, aber warum in dieser Form? Und wie wäre dann zu erklären, dass so viele Chinesen hier Schlange stehen? Und dass, als die politische Führung 2012 – so heisst es - die Aufhebung des Mausoleums diskutierte, eine Welle der Empörung sie dazu brachte, die Idee fallen zu lassen?
Der Tiananmen-Platz mitsamt dem Mao-Mausoleum verkörpert die aktuelle Situation von China immer noch, vielleicht mehr denn je: die eines Reiches, das in ähnlicher Form wie seit Jahrtausenden regiert wird, nur die Hülle ist sogenannt kommunistisch. Es waren ja die sowjetischen Kommunisten unter Stalin, die mit der Einbalsamierung Lenins und seiner Zurschaustellung auf dem Roten Platz als erste moderne Machthaber diese eigenartige Totenehrung im 20. Jahrhundert begründet haben. China als zweite kommunistische Macht folgte nach dem Tod Maos 1976 dem Beispiel. Gleichzeitig folgte es der chinesischen Tradition, den Herrschern und insbesondere den Gründern von Dynastien riesige Grabmäler zu errichten – verglichen mit der unterirdischen Terracotta-Armee des ersten chinesischen Kaisers Qin sShihuang nimmt sich Maos Mausoleum geradezu bescheiden aus, kommunistisch sozusagen.
Denn wie jener Herrscher China geeinigt und damit eine mehr als zweitausendjährige Tradition begründet hatte – er wurde dafür von Mao bewundert, auch wenn er wegen Bücherverbrennungen und grausamer Brutalität in der chinesischen Geschichtsschreibung nicht sehr gut wegkommt -, so hat Mao das Reich aus der Demütigung von Fremdherrschaft und Zerfall befreit , eine 38-jährige Zeit innerer Kämpfe beendet und eine Art neue Dynastie gegründet. Sicher hatte er auch die Idee, eine kommunistische Gesellschaft der Gleichen zu errichten, aber er war sich auch selbst immer der Tradition bewusst, in der er stand. Auf dem Weg nach Peking 1949, als der Sieg der Kommunisten absehbar war, las er nicht Lenin, sondern tausendjährige Schriften über die Herrschaft. Selbstherrlich und rücksichtslos wie ein Kaiser regierte er das Land.
Nachdem die abrupten Wendungen seiner Herrschaft von Deng Xiao Ping immer mehr einer zielstrebigen Entwicklung und Wiederaufrichtung der Grösse Chinas Platz gemacht hatten, wurde immer deutlicher, dass die KPCh eine Art neue Dynastie war. Die Macht wird zwar nicht vererbt, sondern in einem undurchsichtigen, aber mittlerweile rationalisierten Verfahren für jeweils zehn Jahre an ein Führungsduo aus Partei- und Staatschef sowie Ministerpräsident weitergegeben – 2012 fand bereits der dritte solche Wechsel ohne grosse Nebengeräusche statt. Wie im Kaiserreich von der gebildeten konfuzianischen Beamtenschaft wird das Reich faktisch von einer Elite regiert, die sich den Zugang zur Macht formell über die Parteizugehörigkeit, aber auch über intensive Bildung (die Partei führt eigene grosse Kaderbildungsstätten) verschafft – nur ist diese Bildung nicht mehr literarisch wie bei den Konfuzianern (und auch noch bei Mao), sondern mehr ökonomisch, politisch, technisch; ausgebildete Ingenieure überwiegen in der obersten Führung. Indem sie 2004 den seit 1911 verfallenen und umgenutzen Tempel der Alten Kaiser, in welchem seit Jahrhunderten über 200 ehemalige Kaiser und hohe Beamte verehrt wurden, wiedererrichten restaurieren und rekonstruieren liess, stellte die Führung sich selbst in diese Kontiunität der chinesischen Geschchte. Eine neue Dynastie, aber immer noch in kommunistischer Hülle, auch wenn ihre Politik mit Kommunismus wenig mehr zu tun hat.

Im Tempel der Alten Kaiser in Beijing
Das wird auch deutlich im monumentalen Nationalmuseum auf der östlichen Seite des Platzes. Im Untergeschoss gibt es eine grosse, eindrückliche Ausstellung über die vier- bis fünftausendjährige Geschichte Chinas bis zum Fall des Kaiserreichs, ausgewogen kommentiert, schön ausgestellt, modernes Design, moderne Technik, State oft the Art. Die Ausstellung im 1. Stock über die Erneuerung und die Wiederauferstehung Chinas hingegen ist muffig und verstaubt, in heroisierendem Stil dekoriert, mit schlechten Fotoreproduktionen und Historienmalerei im Stil des sog. Sozialistischen Realismus illustriert. Abgestandene marxistische Floskeln statt Darstellung, man geht über Linoleum statt über Marmor und fühlt sich um Jahrzehnte zurückversetzt. Während unten exquisite Vasen aus früheren Epochen ausgestellt werden, trifft man hier auf eine kitschige Porzellankutsche – ein Geschenk von Putin an den vorherigen Staatschef Hu Jintao. Die Fallhöhe zwischen alter und gegenwärtiger Kultur ist hier sehr gross. Die Ausstellung hätte eine Erneuerung dringend nötig.
Mao selbst indes ist, auch wenn seine tatsächliche oder vielleicht auch nur angebliche leibliche Hülle immer noch im Mausoleum gezeigt wird, längst der politischen Sphäre entrückt – sein Portrait ziert, Ironie des Schicksals, die chinesischen Geldscheine und baumelt in Medaillons als Talisman an den Rückspiegeln von Taxi- und Busfahrern, eine Art Buddha.

... link (0 Kommentare) ... comment
Ein Konfuzius-Tempel
wernerbaumann, 11:52h
In einer Platon oder Aristoteles gewidmeten Kirche findet sich eine goldene Statue des Philosophen, vor der Besucher in die Knie gehen, sie zünden für ihn Kerzen an, verbrennen Weihrauch und hinterlassen Votivtafeln mit Wünschen – in Europa gibt es das nicht und es ist auch unvorstellbar, nicht nur weil Platon und Aristoteles längst nicht mehr als unbestrittene Grundlage unserer Kultur gelten. Anders in China. Wenn man den Konfuzius-Tempel in Shanghai besucht, werden ein paar Unterschiede zwischen der chinesischen bzw. konfuzianischen Kultur und der westlichen offenkundig.
Konfuzius, der wohl einflussreichste Denker der Menschheitsgeschichte, hat seit 2'500 Jahren die chinesische Kultur und die der umliegenden Länder geprägt; man kann mit Recht von einem konfuzianischen Kulturkreis reden, der ostasiatische Länder über China hinaus umfasst. Während etwa 2'000 Jahren bildete seine Lehre von Hierarchie und Harmonie bzw. die seiner Nachfolgeschulen mit kurzen Unterbrechungen die Grundlage der chinesischen Staats- und Gesellschaftsphilosophie, zeitweise wurde sie zur Staatsreligion erklärt. Und auch im heutigen China sind sein Ansehen und seine Wirksamkeit wieder gross, nachdem seine Lehre von vielen Intellektuellen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und dann auch von Mao, besonders in der Kulturrevolution, scharf bekämpft worden war. Konfuzius verkörpere eine alte Gesellschaft, die zum Fortschritt nicht fähig sei, ja eine Kultur, die „Menschen fresse“, wie es Lu Xun, der berühmteste chinesische Schriftsteller des 20. Jahrhunderts vor hundert Jahren drastisch ausdrückte. Doch Konfuzius scheint sich zu sehr in der chinesischen DNA festgesetzt zu haben, als dass ihm ein paar Jahrzehnte Gegenwind viel anhaben könnten. Und nicht nur chinesische, auch westliche Denker schwanken in ihren Meinungen über seine Wirkung: Hatte der grosse deutsche Soziologe Max Weber vor hundert Jahren noch ausführlich begründet, warum der Konfuzianismus eine Modernisierung Chinas verhindert habe, so gibt es heute zahlreiche Autoren die den raschen wirtschaftlichen Erfolg Chinas ebenso wie Südkoreas, Taiwans, Singapurs etc. auf den Konfuzianismus zurückführen.
Obwohl Konfuzius gegenüber der Religion und dem Jenseits selbst gleichgültig war, wurden auch ihm ein par hundert Jahre nach seinem Tod Tempel gewidmet. Matteo Ricci, der Jesuit, der Konfuzius seinen latinisierten Namen gab, - er wollte vor 400 Jahren China missionieren und wurde selbst zum halben Konfuzianer – bemerkte nüchtern, Konfuzius habe es vorgezogen, über ein Leben nach dem Tod zu schweigen statt irrige Ideen darüber zu verbreiten. Aber er beobachtete auch, was in China längst bekannt war, nämlich dass bei den ungebildeten Schichten die Grenze von Ahnenverehrung und Anbetung fliessend war. Und so war auch der Konfuzianismus eine der quasireligiösen Strömungen Chinas geworden, neben dem Daoismus und dem Buddhismus, wobei sie sich überschneiden: Man musste und muss sich in den fernöstlichen Gesellschaften nicht für eine richtige Religion entscheiden, man kann auch von jeder nehmen, was einem gefällt. Neben den vielen Areligiösen gibt es in China überdies Muslime und Christen in grosser Zahl; und abergläubisch sind die meisten Chinesen. Ob das wirklich eine Kompensation für den offiziellen Atheismus des Staates sein soll, wie manche meinen, ist allerdings fraglich. Es kann auch einfach die pragmatische Haltung sein, die schon Konfuzius gegenüber Geisterverehrung an den Tag legte: Wenn es jemand für nützlich hält, soll er es tun – „nützt es nichts, so schadet es nichts“.

Rauch für Konfuzius
Ein Konfuzius-Tempel also, in der Shanghaier Altstadt: Man zahlt einen kleinen Eintritt und betritt durch ein schlichtes erstes Tor einen Hof, in dem gerade ein Buchantiquaratsmarkt stattfindet, die Händler sind am Zusammenräumen – passt nicht schlecht zu Konfuzius, dem Lernen und Wissen über alles gingen. Irritierender ist der zweite Hof, wo vor einer Konfuzius-Statue Weihrauchstäbchen verbrannt werden wie in den buddhistischen Tempeln, in der anschliessenden Gebetshalle kniet ein Mann gerade vor der goldenen Statue und betet offenbar. An Gestellen hängen an roten Bändeln unzählige handbeschriebene Wunschzettel, man kann sie nebenan kaufen; „all the best für the whole family“ haben Touristen etwa geschrieben. Als weitere Gebäude gibt es eine schöne Bibliothek und eine schlichte Studierhalle usw., alles im selben Stil mit den geschwungenen Ziegeldächern, in dem alle wichtigen chinesischen Gebäude seit Jahrhunderten bis zum Ende des Kaiserreichs gehalten waren: äusserlich unterschiedet sich der Konfuziustempel nicht vom buddhistischen Lamatempel, aber auch nicht vom Kaiserpalast – „geistliche“ und „weltliche“ Architektur werden nicht unterschieden, weil diese Bereiche nie getrennt waren.

Studierhalle des Konfuzius-Tempels in Shanghai
Der chinesische Staat verstand sich jahrtausendelang als Träger der Zivilisation, die alle Bereiche des Lebens umfasste. Der Herrscher hatte – so das Ideal – mit dem Mandat des Himmels den Auftrag, zum Wohl des Volkes und der Zivilisation zu regieren. Religiöse oder gesellschaftliche (Gegen-)Machtfaktoren gab es nicht. Nur wenn er ganz schlecht regierte, was sich in Hungersnöten, aber auch in Naturkatastrophen zeigen konnte, verlor er das Mandat des Himmels, dann gab es das „Recht“ ihn zu stürzen, und eine neue Dynastie kam an die Macht. Ein Papst, der mit dem Kaiser um die Macht kämpft, eine Kirche, die sich als Gegenmacht versteht, war in dieser Welt ebenso undenkbar wie ein Luther, der zwar dem Staat und der gesellschaftlichen Hierarchie Tribut zollte, dem aber das Gewissen des einzelnen Menschen in religiös-moralischen Dingen entgegenstellte.
Die Idee der Menschenrechte, wie sie im Westen entwickelt wurden in den letzten 250 Jahren, die wesentlich Rechte des einzelnen Menschen gegenüber dem Staat sind, sind in diese Gedankenwelt nur schwer einzuführen. Die Schwierigkeiten Chinas mit dem Thema liegen nicht nur darin, dass es von einem Einparteienregime beherrscht wird, sondern tief in den kulturellen Wurzeln, welche noch heute die Gesellschaft prägen. Wie ein modernes China mit den daraus entstehenden Problemen in einer sich modernisierenden und ein Stück weit individualisierenden Gesellschaft umgehen wird, wird eine der entscheidenden Fragen dieses Jahrhunderts sein – für China, für die Beziehungen zwischen China und der westlichen Welt und für die Welt insgesamt.
Ein Wunschzettel an den menschenfreundliche Philosophen, den der Mann im Tempel anbetet, wird nicht reichen, um sie zu lösen.
Konfuzius, der wohl einflussreichste Denker der Menschheitsgeschichte, hat seit 2'500 Jahren die chinesische Kultur und die der umliegenden Länder geprägt; man kann mit Recht von einem konfuzianischen Kulturkreis reden, der ostasiatische Länder über China hinaus umfasst. Während etwa 2'000 Jahren bildete seine Lehre von Hierarchie und Harmonie bzw. die seiner Nachfolgeschulen mit kurzen Unterbrechungen die Grundlage der chinesischen Staats- und Gesellschaftsphilosophie, zeitweise wurde sie zur Staatsreligion erklärt. Und auch im heutigen China sind sein Ansehen und seine Wirksamkeit wieder gross, nachdem seine Lehre von vielen Intellektuellen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und dann auch von Mao, besonders in der Kulturrevolution, scharf bekämpft worden war. Konfuzius verkörpere eine alte Gesellschaft, die zum Fortschritt nicht fähig sei, ja eine Kultur, die „Menschen fresse“, wie es Lu Xun, der berühmteste chinesische Schriftsteller des 20. Jahrhunderts vor hundert Jahren drastisch ausdrückte. Doch Konfuzius scheint sich zu sehr in der chinesischen DNA festgesetzt zu haben, als dass ihm ein paar Jahrzehnte Gegenwind viel anhaben könnten. Und nicht nur chinesische, auch westliche Denker schwanken in ihren Meinungen über seine Wirkung: Hatte der grosse deutsche Soziologe Max Weber vor hundert Jahren noch ausführlich begründet, warum der Konfuzianismus eine Modernisierung Chinas verhindert habe, so gibt es heute zahlreiche Autoren die den raschen wirtschaftlichen Erfolg Chinas ebenso wie Südkoreas, Taiwans, Singapurs etc. auf den Konfuzianismus zurückführen.
Obwohl Konfuzius gegenüber der Religion und dem Jenseits selbst gleichgültig war, wurden auch ihm ein par hundert Jahre nach seinem Tod Tempel gewidmet. Matteo Ricci, der Jesuit, der Konfuzius seinen latinisierten Namen gab, - er wollte vor 400 Jahren China missionieren und wurde selbst zum halben Konfuzianer – bemerkte nüchtern, Konfuzius habe es vorgezogen, über ein Leben nach dem Tod zu schweigen statt irrige Ideen darüber zu verbreiten. Aber er beobachtete auch, was in China längst bekannt war, nämlich dass bei den ungebildeten Schichten die Grenze von Ahnenverehrung und Anbetung fliessend war. Und so war auch der Konfuzianismus eine der quasireligiösen Strömungen Chinas geworden, neben dem Daoismus und dem Buddhismus, wobei sie sich überschneiden: Man musste und muss sich in den fernöstlichen Gesellschaften nicht für eine richtige Religion entscheiden, man kann auch von jeder nehmen, was einem gefällt. Neben den vielen Areligiösen gibt es in China überdies Muslime und Christen in grosser Zahl; und abergläubisch sind die meisten Chinesen. Ob das wirklich eine Kompensation für den offiziellen Atheismus des Staates sein soll, wie manche meinen, ist allerdings fraglich. Es kann auch einfach die pragmatische Haltung sein, die schon Konfuzius gegenüber Geisterverehrung an den Tag legte: Wenn es jemand für nützlich hält, soll er es tun – „nützt es nichts, so schadet es nichts“.

Rauch für Konfuzius
Ein Konfuzius-Tempel also, in der Shanghaier Altstadt: Man zahlt einen kleinen Eintritt und betritt durch ein schlichtes erstes Tor einen Hof, in dem gerade ein Buchantiquaratsmarkt stattfindet, die Händler sind am Zusammenräumen – passt nicht schlecht zu Konfuzius, dem Lernen und Wissen über alles gingen. Irritierender ist der zweite Hof, wo vor einer Konfuzius-Statue Weihrauchstäbchen verbrannt werden wie in den buddhistischen Tempeln, in der anschliessenden Gebetshalle kniet ein Mann gerade vor der goldenen Statue und betet offenbar. An Gestellen hängen an roten Bändeln unzählige handbeschriebene Wunschzettel, man kann sie nebenan kaufen; „all the best für the whole family“ haben Touristen etwa geschrieben. Als weitere Gebäude gibt es eine schöne Bibliothek und eine schlichte Studierhalle usw., alles im selben Stil mit den geschwungenen Ziegeldächern, in dem alle wichtigen chinesischen Gebäude seit Jahrhunderten bis zum Ende des Kaiserreichs gehalten waren: äusserlich unterschiedet sich der Konfuziustempel nicht vom buddhistischen Lamatempel, aber auch nicht vom Kaiserpalast – „geistliche“ und „weltliche“ Architektur werden nicht unterschieden, weil diese Bereiche nie getrennt waren.

Studierhalle des Konfuzius-Tempels in Shanghai
Der chinesische Staat verstand sich jahrtausendelang als Träger der Zivilisation, die alle Bereiche des Lebens umfasste. Der Herrscher hatte – so das Ideal – mit dem Mandat des Himmels den Auftrag, zum Wohl des Volkes und der Zivilisation zu regieren. Religiöse oder gesellschaftliche (Gegen-)Machtfaktoren gab es nicht. Nur wenn er ganz schlecht regierte, was sich in Hungersnöten, aber auch in Naturkatastrophen zeigen konnte, verlor er das Mandat des Himmels, dann gab es das „Recht“ ihn zu stürzen, und eine neue Dynastie kam an die Macht. Ein Papst, der mit dem Kaiser um die Macht kämpft, eine Kirche, die sich als Gegenmacht versteht, war in dieser Welt ebenso undenkbar wie ein Luther, der zwar dem Staat und der gesellschaftlichen Hierarchie Tribut zollte, dem aber das Gewissen des einzelnen Menschen in religiös-moralischen Dingen entgegenstellte.
Die Idee der Menschenrechte, wie sie im Westen entwickelt wurden in den letzten 250 Jahren, die wesentlich Rechte des einzelnen Menschen gegenüber dem Staat sind, sind in diese Gedankenwelt nur schwer einzuführen. Die Schwierigkeiten Chinas mit dem Thema liegen nicht nur darin, dass es von einem Einparteienregime beherrscht wird, sondern tief in den kulturellen Wurzeln, welche noch heute die Gesellschaft prägen. Wie ein modernes China mit den daraus entstehenden Problemen in einer sich modernisierenden und ein Stück weit individualisierenden Gesellschaft umgehen wird, wird eine der entscheidenden Fragen dieses Jahrhunderts sein – für China, für die Beziehungen zwischen China und der westlichen Welt und für die Welt insgesamt.
Ein Wunschzettel an den menschenfreundliche Philosophen, den der Mann im Tempel anbetet, wird nicht reichen, um sie zu lösen.
... link (0 Kommentare) ... comment
Eine chinesische Mittelschule
wernerbaumann, 11:23h
Die Xian Foreign Language School affiliated to Xian International Studies University – so heisst der offizielle Name auf Englisch – liegt in einem Wohnquartier nördlich des Zentrums von Xian, umgeben vom üblichen Trubel, der in solchen Quartieren herrscht: unzählige Läden, Restaurants, auf den Strassen werden Nahrungsmittel und alles mögliche sonst verkauft, Hochhäuser zwischen älteren niedrigeren Wohn- und Gewerbehäusern, enge „Essgassen“ und breite Autostrassen. Eine Primarschule und eine Mittelschule für die Schuljahre 7 bis 12 – insgesamt etwa dreitausend Schülerinnen und Schüler. Die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler wohnen während der Woche auf dem Schulareal zusammen mit Betreuungslehrpersonen, die nicht unterrichten; in drei Häusern im Hof nebenan wohnen auch Lehrpersonen, manche sind pensioniert, manche leben nur unter der Woche hier. Es sind geräumige 3-Zimmerwohnungen, ich habe eine im 5. Stock (ohne Lift) – junge Lehrerinnen und Lehrer, die zu weit weg wohnen, teilen sich durch die Woche eine solche, teils bis zu dreizehn in einer Wohnung, die mit Doppelstockbetten gefüllt ist, dafür müssen sie nur den Strom bezahlen; bei weniger als umgerechnet 500 Fr. Monatslohn ist das willkommen, ebenso wie das günstige Mensa-Essen, das 30 bis 50 Rp. kostet, und für das man Schalen und Besteck selber mitbringen muss.

Sowohl das Schulareal wie der Hof mit den Wohnblöcken der Lehrer ist abschliessbar, wie das in China üblich ist. Am Eingang zum Areal mit den drei Wohnhäusern sitzt ein rundlicher Portier in einem Kabäuschen, meist ist die Frau dabei und ein paar Leute, die hier für einen Schwatz vorbeikommen; bei schönem Wetter sitzen alle draussen. Um elf Uhr abends schliesse er das Tor; wenn man später komme, könne man versuchen ihn durch Rufen zu wecken, sonst gehe es um sechs wieder auf.
Gleich nebenan beim Eingang zur Schule, den Sportplätzen und Schülerhäusern hat es eine richtige Portierloge neben der abschliessbaren Einfahrt. Am Donnerstag vor Schulbeginn ist noch nicht viel los, Bauarbeiter sind mit dem Ausbessern des Bodenbelags beschäftigt. Auf einem Plakat sind die Resultate der Absolventinnen und Absolventen der nationalen Prüfungen, die über den Hochschulzugang entscheiden, aufgelistet. Der beste Absolvent erreichte 650 Punkte, das ist gut, aber für die Aufnahme in eine Eliteuni hat es keinem gereicht, da bräuchte man 690-700 (von750) – das ist hier keine Eliteschule. Eine Deutschlehrerin zeigt mir das Schulhaus. Ein Abteilungsleiter in einem kleinen Büro beim Eingang begrüsst mich freundlich, kann allerdings keine Fremdsprache („language is power“ steht auf einem Plakat vor der Schule, allerdings ist auch die chinesische Sprache ausdrücklich genannt); er hat ein Pult in einem der kleinen Lehrerzimmer für mich bestimmt. Er scheint der einzige im Haus zu sein. Die Schulzimmer sind nach zwei Monaten Ferien noch staubig, nichts deutet auf den bevorstehenden Anfang hin. Ich soll am Montag wieder kommen, heisst es. Der Stundenplan sei auch noch nicht vorhanden. Am Samstag werde ich per SMS darauf aufmerksam gemacht, dass mein persönlicher Stundenplan noch nicht gemacht sei, die erste Woche könne ich nutzen, um den Unterricht bei anderen Deutschlehrern (es sind sechs Frauen, die meisten jung, zwei davon schwanger) zu besuchen und die Schüler kennenzulernen.

Das Schulhaus der Mittelschule (24 Klassen 7.-9., 12 Klassen 10.-12. Schuljahr). Der Sportplatz ist asphaltiert und bemalt.
Am ersten Schultag ist dann grosser Betrieb, die Portiers am Eingang tragen Uniform, einer sogar zeitweise einen Helm. Sie kontrollieren, wer hinein und wer hinaus will – nicht alle Schüler dürfen z. B. am frühen Abend hinaus, manche werden zurückgehalten, andere schleichen grinsend an der Kontrolle vorbei. Zu erkennen sind sie leicht an der „Schuluniform“, die aus einem Trainingsanzug besteht. Im Schulhaus überall Unterricht bei meist offenen Türen – das ganze Schulhaus summt wie ein Bienenstock, vor allem, weil in vielen Klassen im Chor wiederholt wird, was der Lehrer sagt; Lehrerinnen haben nicht selten ein Mikrofon, wenn sie vor 40-50 Schülerinnen stehen. Der Umgang zwischen Lehrpersonen und Schülern ist eher informell. Die Klassen sitzen recht diszipliniert auf kleinen Hockern an kleinen Tischchen in den engen Räumen; es können wie gesagt bis 50 Schülerinnen und Schüler pro Klasse sein, in den Spezialfächern wie Deutsch gibt es aber auch ganz kleine Klassen von sieben oder gar drei. Der Geräuschpegel während der Lektionen ist teilweise recht hoch, manchmal, weil die Schüler untereinander reden, manchmal, weil vom Gang oder vom Sportplatz der Primarschüler Gekreisch zu hören ist – der Lärm scheint die Konzentration aber wenig zu beeinträchtigen. Ansonsten das übliche Bild von Unterricht: einige sind sehr eifrig, die meisten aufmerksam, einzelne hängen eher in den Seilen.
Das Schulhaus ist für Schweizer Verhältnisse arg heruntergekommen, gewöhnungsbedürftig sind vor allem die wie an einem Bahnhof zum Gang hin offenen WC-Abteile auf jedem Stockwerk, aus denen ein zeitweise penetranter Pissegeruch auf den Gang dringt (auch die WC-Abteile im Inneren sind nur durch halbhohe Wände getrennt, Türen gibt es nicht). Auf jedem Zwischenboden des fünfstöckigen Treppenhauses ist ein grosser Merkspruch auf einem blauen Tafelbild aufgehängt, auf chinesisch und englisch:
„Be polite, friendly, honest and reliable“, heisst es da. „Cherish our health, beautify our environment and love our school“ und „Study diligently and hard: devote ourselves to our study. And develop ourselves in all aspects.“ Weiter werden grosse Männer wie Lincoln oder Bacon („Knowledge is power“) zitiert, oder der vor bald zwanzig Jahren verstorbene grosse chinesische Modernisierer und Staatsmann Deng Xiao Ping: „Educational undertakings must serve the needs of modernizations, face the world and look into the future.“ Schliesslich – natürlich – Konfuzius, mit einem allerdings erstaunlichen Zitat: „By asking we learn. It’s wise to announce one’s comprehension and to admit one’s confusion.“ Erstaunlich deshalb, weil er hier – vor 2500 Jahren – etwas fordert, was nach allgemeiner Ansicht vielen Chinesen auch heute noch schwerfällt: zuzugeben, dass man etwas nicht verstanden hat, und zu nachzufragen, das heisst auch selbständig zu denken. Das Zitat zeigt, wie wenig Konfuzius auf eine Formel reduziert werden kann, wie komplex sein Denken ist, es zeigt aber auch etwas vom Geist dieser Schule – der Rektor hat das Zitat bewusst ausgewählt.

Im Schulhaus hat man nicht den Eindruck von Stress und Hektik, obwohl die Schüler sehr lange Präsenzzeiten haben, manchmal abends bis 21 Uhr. Die Lehrpersonen sitzen tagsüber, wenn sie nicht Stunden haben, in ihren Büros, auch sie haben eine grosse Präsenzzeit, sind aber immer mal wieder auch nicht da oder mit ihrem Handy beschäftigt oder schlafen am Pult. Zehn bis 25 Wochenlektionen sind zu unterrichten neben Hausaufgabenaufsicht. Das ist je nachdem, was dazukommt, viel oder auch nicht so viel. Zwei Schülerinnen und ein Schüler der Abschlussklasse, mit denen ich am Freitag nach der Schule etwas trinke, klagen über die strenge Schule, die sie täglich bis neun Uhr abends mit Hausaufgaben traktiere und auch übers Wochenende, sie glauben, die Schüler in der Schweiz hätten es viel schöner. Alle drei waren schon mal in Deutschland, in den Ferien oder in einem Austausch. Sie schwärmen von England, USA, Deutschland, möchten gern einmal nach Hongkong gehen.

Sowohl das Schulareal wie der Hof mit den Wohnblöcken der Lehrer ist abschliessbar, wie das in China üblich ist. Am Eingang zum Areal mit den drei Wohnhäusern sitzt ein rundlicher Portier in einem Kabäuschen, meist ist die Frau dabei und ein paar Leute, die hier für einen Schwatz vorbeikommen; bei schönem Wetter sitzen alle draussen. Um elf Uhr abends schliesse er das Tor; wenn man später komme, könne man versuchen ihn durch Rufen zu wecken, sonst gehe es um sechs wieder auf.
Gleich nebenan beim Eingang zur Schule, den Sportplätzen und Schülerhäusern hat es eine richtige Portierloge neben der abschliessbaren Einfahrt. Am Donnerstag vor Schulbeginn ist noch nicht viel los, Bauarbeiter sind mit dem Ausbessern des Bodenbelags beschäftigt. Auf einem Plakat sind die Resultate der Absolventinnen und Absolventen der nationalen Prüfungen, die über den Hochschulzugang entscheiden, aufgelistet. Der beste Absolvent erreichte 650 Punkte, das ist gut, aber für die Aufnahme in eine Eliteuni hat es keinem gereicht, da bräuchte man 690-700 (von750) – das ist hier keine Eliteschule. Eine Deutschlehrerin zeigt mir das Schulhaus. Ein Abteilungsleiter in einem kleinen Büro beim Eingang begrüsst mich freundlich, kann allerdings keine Fremdsprache („language is power“ steht auf einem Plakat vor der Schule, allerdings ist auch die chinesische Sprache ausdrücklich genannt); er hat ein Pult in einem der kleinen Lehrerzimmer für mich bestimmt. Er scheint der einzige im Haus zu sein. Die Schulzimmer sind nach zwei Monaten Ferien noch staubig, nichts deutet auf den bevorstehenden Anfang hin. Ich soll am Montag wieder kommen, heisst es. Der Stundenplan sei auch noch nicht vorhanden. Am Samstag werde ich per SMS darauf aufmerksam gemacht, dass mein persönlicher Stundenplan noch nicht gemacht sei, die erste Woche könne ich nutzen, um den Unterricht bei anderen Deutschlehrern (es sind sechs Frauen, die meisten jung, zwei davon schwanger) zu besuchen und die Schüler kennenzulernen.

Das Schulhaus der Mittelschule (24 Klassen 7.-9., 12 Klassen 10.-12. Schuljahr). Der Sportplatz ist asphaltiert und bemalt.
Am ersten Schultag ist dann grosser Betrieb, die Portiers am Eingang tragen Uniform, einer sogar zeitweise einen Helm. Sie kontrollieren, wer hinein und wer hinaus will – nicht alle Schüler dürfen z. B. am frühen Abend hinaus, manche werden zurückgehalten, andere schleichen grinsend an der Kontrolle vorbei. Zu erkennen sind sie leicht an der „Schuluniform“, die aus einem Trainingsanzug besteht. Im Schulhaus überall Unterricht bei meist offenen Türen – das ganze Schulhaus summt wie ein Bienenstock, vor allem, weil in vielen Klassen im Chor wiederholt wird, was der Lehrer sagt; Lehrerinnen haben nicht selten ein Mikrofon, wenn sie vor 40-50 Schülerinnen stehen. Der Umgang zwischen Lehrpersonen und Schülern ist eher informell. Die Klassen sitzen recht diszipliniert auf kleinen Hockern an kleinen Tischchen in den engen Räumen; es können wie gesagt bis 50 Schülerinnen und Schüler pro Klasse sein, in den Spezialfächern wie Deutsch gibt es aber auch ganz kleine Klassen von sieben oder gar drei. Der Geräuschpegel während der Lektionen ist teilweise recht hoch, manchmal, weil die Schüler untereinander reden, manchmal, weil vom Gang oder vom Sportplatz der Primarschüler Gekreisch zu hören ist – der Lärm scheint die Konzentration aber wenig zu beeinträchtigen. Ansonsten das übliche Bild von Unterricht: einige sind sehr eifrig, die meisten aufmerksam, einzelne hängen eher in den Seilen.
Das Schulhaus ist für Schweizer Verhältnisse arg heruntergekommen, gewöhnungsbedürftig sind vor allem die wie an einem Bahnhof zum Gang hin offenen WC-Abteile auf jedem Stockwerk, aus denen ein zeitweise penetranter Pissegeruch auf den Gang dringt (auch die WC-Abteile im Inneren sind nur durch halbhohe Wände getrennt, Türen gibt es nicht). Auf jedem Zwischenboden des fünfstöckigen Treppenhauses ist ein grosser Merkspruch auf einem blauen Tafelbild aufgehängt, auf chinesisch und englisch:
„Be polite, friendly, honest and reliable“, heisst es da. „Cherish our health, beautify our environment and love our school“ und „Study diligently and hard: devote ourselves to our study. And develop ourselves in all aspects.“ Weiter werden grosse Männer wie Lincoln oder Bacon („Knowledge is power“) zitiert, oder der vor bald zwanzig Jahren verstorbene grosse chinesische Modernisierer und Staatsmann Deng Xiao Ping: „Educational undertakings must serve the needs of modernizations, face the world and look into the future.“ Schliesslich – natürlich – Konfuzius, mit einem allerdings erstaunlichen Zitat: „By asking we learn. It’s wise to announce one’s comprehension and to admit one’s confusion.“ Erstaunlich deshalb, weil er hier – vor 2500 Jahren – etwas fordert, was nach allgemeiner Ansicht vielen Chinesen auch heute noch schwerfällt: zuzugeben, dass man etwas nicht verstanden hat, und zu nachzufragen, das heisst auch selbständig zu denken. Das Zitat zeigt, wie wenig Konfuzius auf eine Formel reduziert werden kann, wie komplex sein Denken ist, es zeigt aber auch etwas vom Geist dieser Schule – der Rektor hat das Zitat bewusst ausgewählt.

Im Schulhaus hat man nicht den Eindruck von Stress und Hektik, obwohl die Schüler sehr lange Präsenzzeiten haben, manchmal abends bis 21 Uhr. Die Lehrpersonen sitzen tagsüber, wenn sie nicht Stunden haben, in ihren Büros, auch sie haben eine grosse Präsenzzeit, sind aber immer mal wieder auch nicht da oder mit ihrem Handy beschäftigt oder schlafen am Pult. Zehn bis 25 Wochenlektionen sind zu unterrichten neben Hausaufgabenaufsicht. Das ist je nachdem, was dazukommt, viel oder auch nicht so viel. Zwei Schülerinnen und ein Schüler der Abschlussklasse, mit denen ich am Freitag nach der Schule etwas trinke, klagen über die strenge Schule, die sie täglich bis neun Uhr abends mit Hausaufgaben traktiere und auch übers Wochenende, sie glauben, die Schüler in der Schweiz hätten es viel schöner. Alle drei waren schon mal in Deutschland, in den Ferien oder in einem Austausch. Sie schwärmen von England, USA, Deutschland, möchten gern einmal nach Hongkong gehen.
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 15. September 2014
Xian
wernerbaumann, 11:37h
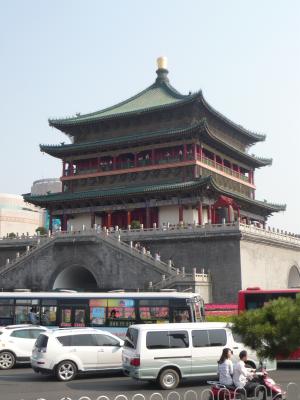
Glockenturm Xian
Xian zählt sich in den Tourismusprospekten zusammen mit Kairo, Rom und Athen zu den ältesten Kulturstädten der Welt. Tatsächlich liegt es sozusagen im Herzen der chinesischen Kultur und war – lange unter dem Namen Chang’an (langer Friede) und zunächst etwas versetzt gegenüber der heutigen Stadt – zwischen dem 11. Jahrhundert v. Chr. und dem 10. n. Chr. immer wieder Hauptstadt, insgesamt während rund tausend Jahren, zunächst eines Zhou-Königreichs, dann ab 221 v. Chr. des neuen Kaiserreichs, bis dann die Hauptstadt zunächst nach Süden (Nanjing: südliche Hauptstadt) und schliesslich nach Norden (Beijing: nördliche Hauptstadt) verlegt wurde und Xi’an (westlicher Friede) seinen heutigen Namen bekam. Als Hauptstadt und Ausgangspunkt der Seidenstrasse dürfte es während längerer Perioden, vor allem im 1. Jahrtausend n. Chr., jeweils die grösste Stadt der Welt gewesen sein. Die heute immer noch fast vollständige, imposante Stadtmauer geht auf das 7. Jh. n. Chr. zurück und erhielt ihre heutige Gestalt in der Zeit der Mingdynastie (europäisches Mittelalter). Sie umschliesst als 14.5 km langes Rechteck eine riesige „Altstadt“, in der allerdings nur mehr wenige alte Gebäude erhalten sind. Die wie in allen historischen Städten Chinas schachbrettartige Anlage mit den vielen Häusern aus den letzten Jahrzehnten und den Hochhäusern ergibt das Bild einer modernen Allerweltsstadt. Verstreut liegen die wenigen historischen Relikte wie der zentrale Glockenturm und der Trommelturm (beide aus der Mingzeit) oder das dahinter liegende historische Muslimviertel, in dem eine mehr als 1200 Jahre alte Moschee in der Gestalt eines chinesischen Tempels von der Integrationskraft der chinesischen Kultur zeugt.

Blick über eine Allerweltsstadt?
Wenn Xian heute ein touristisches Highlight ist, dann nicht wegen der erwähnten historischen Relikte, zu denen ausserhalb der Mauer noch die kleine und die grosse Wildganspagode (ebenfalls gut 1200-1300 Jahre alte Relikte der Tang-Dynastie) kommen, sondern wegen des Grabmals des ersten Kaisers Qin Sihhuangdi. Der brutale, aber als Einiger Chinas gefeierte Herrscher hatte sich ein ganzes Heer anfertigen lassen und sie neben lebendigen Menschen ins Jenseits mitgenommen. Seit in den 1970er Jahren diese riesige Armee von Terraccotta-Kriegern ausgegraben worden ist und als eine der grossen archäologischen Sensationen weltweite Aufmerksamkeit erregt hat, gehört sie zu den Pflichtprogrammen von China-Reisen. Noch birgt der Lössboden der Umgebung von Xian zahlreiche weitere Schätze, die z. T. bewusst nicht ausgegraben werden, weil man hofft, vorher bessere Konservierungsmethoden zu finden, damit nicht die Farben wie bei den bisherigen Ausgrabungen sofort zerfallen. Bis jetzt verleiht die gelbgraue Schlichtheit den lebensgrossen Terracottakriegern mit ihren individualiserten Gesichtern eine sozusagen klassische Aura, und man kann sich die Farben ähnlich schlecht vorstellen wie an den griechischen Statuen.

Auf der Stadtmauer
Eine mittlere chinesische Stadt also, vier Mio. Einwohner, mit der Metropolitanregion sind es acht Mio. Diejenigen, welche in der Schweiz, wo man sich in Wohnquartieren auf der Strasse meist ziemlich einsam vorkommt, das Wort Dichtestress erfunden haben, würden sich hier wundern. Auch hier gibt es Staus, selbst wenn die Strassen mitten in der Stadt acht Spuren haben. Vor allem aber gibt es fast überall, besonders in den öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Rolltreppen und Trottoirs viele, manchmal sehr viele Menschen. Das ist hier allerdings nicht neu; man nimmt an, dass Xian
spätestens während der Tang-Dynastie – in der zweiten Hälfte des 1. Jahrtausends – als es in Europa keine Städte (mehr) gab, eine Million Einwohner hatte. So nimmt man hier die Dichte gelassen und bewegt sich meist geschickt, so dass es kaum Zusammenstösse gibt. Wird man trotzdem mal angestossen, so weicht der andere sofort zurück, eine Entschuldigung gibt es so wenig, wie sie im umgekehrten Fall erwartet wird, aber auch keine bösen Blicke. Merkwürdig ist, dass sich hier an den Bushaltestellen sofort Schlangen wie in England bilden, während in der U-Bahn, wenn es viele Leute hat, trotz Markierung und ständiger Aufforderung durch Lautsprecher, die Wartenden schnell hineinzudrängen beginnen, während die Aussteigenden um so mehr drängen müssen, um herauszukommen. Ob es daran liegt, dass es die U-Bahn hier erst seit ein paar Jahren gibt?
Im Quartier nördlich der Altstadt, wo ich wohne, gibt es den üblichen Mix von älteren Gebäuden und neueren Hochhäusern, die Strassen sind teils sehr belebt, unzählige Läden und Restaurants, Strassenverkäufer, enge Essstrassen, wo man Nahrungsmittel und fertige Gerichte von festen oder mobilen Händlern erwerben kann. Auch wo die neuen rund 30-stöckigen Wohnhäuser stehen, ist das Strassenbild nicht viel anders, weil zur Strasse hin auch hier wieder ein Trakt mit den typischen schmalen, tiefen Kleinläden gebaut wurde. Verlaufen kann man sich kaum, weil auch hier das rechtwinklige Strassenmuster weitergeführt wurde, ob man je den Stadtrand erreichen würde zu Fuss ist allerdings fraglich – wenn man eine halbe Stunde geht, sieht es immer noch gleich aus und die Strasse heisst auch noch gleich.
... link (3 Kommentare) ... comment